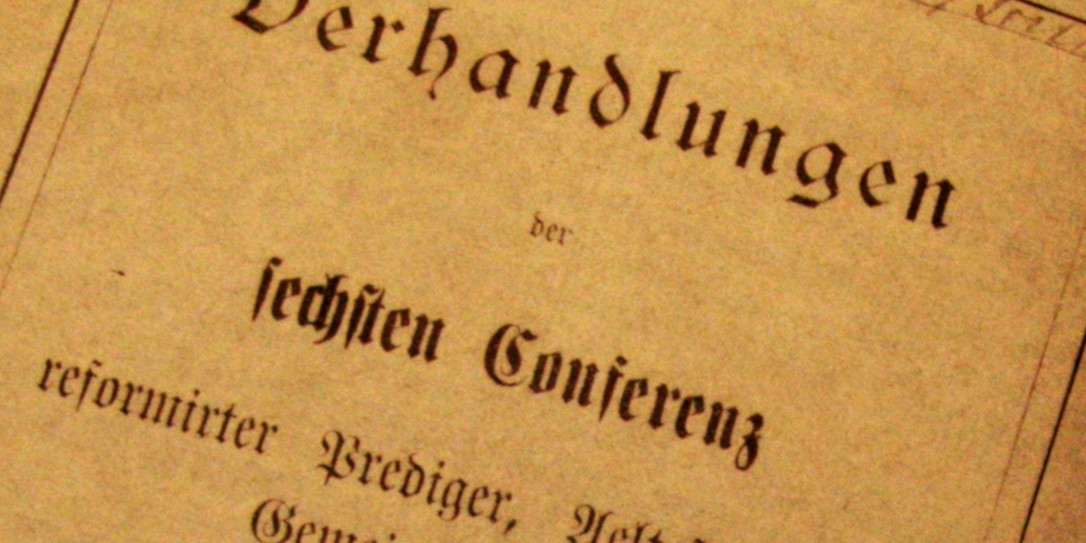Wichtige Marksteine
Reformierte im Spiegel der Zeit
Geschichte des Reformierten Bunds
Geschichte der Gemeinden
Geschichte der Regionen
Geschichte der Kirchen
Biografien A bis Z
(1528–1572)
Jeanne d´Albret (1528–1572) war die bedeutendste Frau in der Geschichte der Hugenotten im 16. Jahrhundert. Besonders in ihrem Witwenstand, in den letzten zehn Jahren ihres Lebens, baute sie eine reformierte Kirche in Béarn auf und war das politische Oberhaupt der Hugenotten im dritten Religionskrieg (1568–1570). Nach 1570 versuchte sie, die Reformierten zu schützen und ihnen einen gesicherten Platz in der Gesellschaft zu verschaffen. Sie handelte für die Hugenotten den Friedensschluss von St. Germain 1570 aus, und durch die Heirat ihres Sohnes Heinrich (später Heinrich IV. von Frankreich) mit Margarete von Valois, Schwester des Königs Karl IX. von Frankreich, strebte sie eine enge Verbindung von Hugenotten und Katholiken an.
Keine andere Frau hatte eine solche Machtposition unter den Hugenotten in Frankreich inne. Sie war respektiert und gefürchtet in Rom und Madrid, alliiert mit Elizabeth von England und befreundet mit Katharina von Medici – keine unkomplizierte Freundschaft zwischen zwei starke Frauen.
Sie sorgte dafür, dass ihre Kinder – Heinrich und Katharina – im reformierten Glauben erzogen wurden. Jahrelang kämpfte Heinrich als Anführer der Hugenotten und von einer Machtbasis in Südfrankreich aus um die französische Krone, bis er 1589 König von Frankreich wurde und schließlich 1593 zum katholischen Glauben übertrat, um das Land zu befrieden.
Jeanne d´Albret war nicht nur Mutter ihres berühmten Sohnes, sie war auch selbst eine machtvolle Frau in Frankreich, da ihre Position als Anführerin der Hugenotten ihr einen Einfluss weit über die Grenzen ihres kleinen Königreiches zusicherte.
Jugend und Ehe (1528-1555)
Jeanne d´Albret wurde am 7. November 1528 auf dem Schloss Blois von Margarete und Heinrich II. von Navarra geboren. Ihre Mutter wusste angeblich, dass sie eine Tochter gebären würde, ihr sehnlichster Wunsch war freilich nach einem Sohn. Jeanne blieb das einzige Kind aus dieser Ehe, Margarete von Navarra gebar zwar kurz danach einen Sohn, der als Kleinkind starb, und alle übrigen Hoffnungen auf Schwangerschaften zerschlugen sich.
Die kleine Prinzessin konnte von ihrem Vater das Königreich Navarra erben, weil dort das salische Gesetz, das in Frankreich weibliche Thronerben verbot, nicht gültig war. Außerdem war das vicomté Béarn selbständig. Deswegen waren die zwei Großmächte Spanien und Frankreich zutiefst an diesen Grenzregionen interessiert. Frankreich wollte seine Südgrenze verteidigen, und Spanien beide Seiten der Pyrenäen besitzen, um in Frankreich einfallen zu können. Zudem war die väterliche Familie von Albret Großgrundbesitzer in Südwestfrankreich und damit Vasall des französischen Königs. Das frühere Aquitanien hatte mehrere hundert Jahre der englischen Krone gehört und war spät von England aufgegeben worden. Im 16. Jahrhundert wurde das Gebiet meistens als Guyenne bezeichnet.
In ihren jungen Jahren wuchs Jeanne in der Normandie auf. Ihre Mutter, Margarete von Navarra, hatte die Aufgabe, die königlichen Kinder ihres Bruders, Franz I., zu erziehen. Sie gab Jeanne in die Obhut ihrer Freundin Aymée de Lafayette, Vogtin von Caen. Man behauptet, sie sei die Vorlage für die Figur Longarine in Heptameron (vgl. Nielsen). Nach meiner Auffassung sind die Erzähler/innen im Heptameron, die sogenannten devisants, eher Typen als historische Persönlichkeiten, die Figur der Longarine ist allerdings eine sehr sympathische Frau mit Humor und Pfiff. Wenn Aymée de Lafayette die Vorlage zu Longarine abgegeben haben soll, deutet alles darauf hin, dass Margarete sie sehr schätzte und meinte, ihre Tochter sei bei ihr gut aufgehoben.
Jeanne wuchs in einem landadligen Milieu auf, umgeben von Wald, Wiesen und Tieren, mit den Mitgliedern der Familie von Aymée de Lafayette als Bezugspersonen, bis sie zehn Jahre alt war. Ihre Mutter sah sie selten, aber jedes Mal, wenn sie krank war, war Margarete sofort zur Stelle. 1538 ließ Franz I. sie nach Plessis-lez-Tours bei der Loire übersiedeln, da sie jetzt ein Alter erreicht hatte, wo sie auf dem Heiratsmarkt von Interesse war. Der König konnte über seine Verwandte entscheiden und Ehen arrangieren, wie es ihm passte.
1540 war es für Jeanne so weit. Herzog Wilhelm der Reiche von Kleve-Jülich-Berg hatte 1538 das Herzogtum Geldern geerbt. Sein Erbanspruch wurde von Kaiser Karl V. angefochten und auf dem Reichstag zu Regensburg wurde dem Kaiser Geldern zugeteilt. 1539 folgte Wilhelm seinem Vater auf dem Thron nach, und um sich vor den Ansprüchen des Kaisers zu schützen, arrangierte er eine Ehe mit Heinrich VIII. von England für seine Schwester Anna, und selbst verbündete er sich mit Franz I. Als Unterpfand für dieses Bündnis sollte er Jeanne d´Albret heiraten.
Was jetzt passierte, ist absolut ungewöhnlich: Jeanne weigerte sich. Die Zwölfjährige ließ ihrem Onkel wissen, dass sie den Herzog nicht heiraten möchte, und sie ließ zwei Schreiben aufsetzen, in welchen sie erklärte, dass sie gegen ihren Willen zu dieser Ehe gezwungen worden sei. Natürlich konnte sie sich nicht auf Dauer gegen den Willen des Königs auflehnen, aber bei der Hochzeitszeremonie am 14. Juni 1541 weigerte sie sich, zum Altar zu schreiten, stattdessen musste sie getragen werden. Ihr Jawort war nicht hörbar und wegen ihres Alters wurde die Ehe nicht vollzogen, der Herzog setzte nur symbolisch ein Bein in ihr Bett. Nach der Hochzeit kehrte er zurück nach Düsseldorf, während Jeanne vorläufig in Frankreich blieb.
1543 griff Kaiser Karl Kleve-Jülich-Berg an, der Herzog wurde geschlagen und musste Geldern Karl V. überlassen. Am Frieden von Venlo im September 1543 hob er das Bündnis mit Franz I. auf und verbündete sich stattdessen mit dem Kaiser. Damit war auch die französische Ehe hinfällig geworden, 1545 wurde sie vom Papst wegen Nichtvollzug annulliert, und der Herzog vermählte sich mit einer Nichte des Kaisers.
Nach kanonischem Recht durfte bei einer Eheschließung keine Zwang im Spiel sei. Die Eheleute mussten ihr Gelübde frei abgeben. Damals konnten junge Frauen aus adligen oder königlichen Familien sich ihre Ehepartner nicht selbst aussuchen, sondern wurden als politische Garanten vermählt, und die meisten fanden sich damit ab, weil das ihr Standesbild entsprach. Jeannes Ablehnung, so wie ihre Kenntnis des kanonischen Rechts, ist erklärungsbedürftig.
Eine mögliche Erklärung ist, dass ihre Eltern für sie eine Ehe mit dem Kronprinzen Philipp von Spanien anstrebten. Königin von Spanien war natürlich prestigeträchtiger als Herzogin von Kleve zu sein, aber vor allem erhoffte sich ihr Vater damit den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. 1512 hatten die Spanier Navarra, das Baskenland, bis zu den Pyrenäen erobert und den Albrets nur das winzige Gebiet auf der französischen Seite gelassen. Seitdem überlegten sich die Könige von Navarra, wie sie zu ihrem ganzen Erbe kommen konnten, und eine Ehe zwischen dem Infanten von Spanien und der zukünftigen Königin von Navarra würde genau dies herbeiführen.
Jeanne war möglicherweise auch beeinflusst von einer Erklärung der Ständeversammlung von Béarn, die eine auswärtige Ehe für ihre Kronprinzessin ablehnte.
Sah Jeanne d´Albret ihre Zukunft gefährdet durch eine Ehe mit dem Herzog von Kleve? Oder tat sie, was ihre Eltern wünschten, statt des Königs Willen zu erfüllen? Stammten ihre Kenntnisse des kanonischen Rechts von denen? Margareta von Navarra schrieb ihrem Bruder, sie habe keine Ahnung, was in das Mädchen gefahren sei, aber stimmt das? Hat sie Jeanne mit ihrer Ablehnung der Ehe geholfen aus Liebe (Cholakian & Cholakian), oder aus Ehrgeiz? Es besteht kein Zweifel, dass königliche Kinder damals frühreif waren und in jungen Jahren schon an ihre späteren Aufgaben geführt wurden, trotzdem ist die Zähigkeit und Sturheit des Mädchens erstaunlich.
1547 starb Franz I. und als Jeanne zwanzig Jahre alt war, bot der Nachfolger, Heinrich II. von Frankreich, ihr gleich zwei Heiratskandidaten an: den Herzog Franz von Aumale (der spätere erzkatholische Herzog Franz von Guise) und Anton von Bourbon, Herzog von Vendôme. Der letztere war Erbprinz und vielleicht deshalb für Jeanne die bessere Partie, obwohl er relativ arm war. Er war hochgewachsen – was für einen Bourbon eher selten war – und charmant, wie alle Männer in seiner Familie scheint er ein unverbesserlicher Schürzenjäger gewesen zu sein. Heinrich IV. von Frankreich, der vert galant, hatte seine ausgelebte Sexualität nicht von Fremden, ebenso wenig wie sein militärisches Können und seinen Mut.
Jeanne und Anton von Bourbon heirateten 1548 und sie war überglücklich. Heinrich II. schrieb in einem Brief, dass er selten eine Braut erlebt habe, die immer nur lachte. Diese Ehe war aus Liebe geschlossen, und Anton von Bourbon nahm seine Frau mit, als er in den Krieg zog. Der Kriegsschauplatz war Flandern, und da der Herzog Güter in Nordfrankreich besaß, zog Jeanne in den ersten Jahren ihrer Ehe von Schloss zu Schloss, immer in der Hoffnung, dass sie und Anton von Bourbon sich treffen könnten.
1551 gebar sie ihren ersten Sohn und gab ihn an Aymée de Lafayette, die sie selbst erzogen hatte. Ob nun Frau de Lafayette alt oder übervorsichtig geworden war, der kleine Herzog von Beaumont starb als Kleinkind, angeblich weil er von Wärme erstickt worden sei.
Bald wurde Jeanne wieder schwanger, und während ihr ältester Sohn in Nordfrankreich geboren war, sollte das zweite Kind in Béarn zu Welt kommen. Sie unternahm die lange Reise nach Süden und kam gerade rechtzeitig in Pau an, 14 Tage bevor sie von ihrem zweiten Sohn, Heinrich, auf dem Schloss in Pau entbunden wurde. Es wurde entschieden, dass dieser Junge in Pau bleiben sollte. Der Großvater, Heinrich d´Albret, wollte wahrscheinlich mit diesem kleinen Prinzen die Erbfolge in Béarn und Navarra sichern. Die Legenden von der rauen Erziehung Heinrichs seitens des Großvaters können jedoch nicht wahr sein, allein weil das Kind die ersten Jahre von Ammen betreut wurde, und der Großvater starb, als es zwei Jahre alt war. Es scheint in Béarn Sitte gewesen zu sein, die Lippen des Täuflings mit Rotwein und Knoblauch einzureiben, eine Taufe à la Gascogne, aber die Mär, dass Heinrich barfuß unter den Hirten in den Bergen aufgewachsen sein soll, ist reine Legende. Der spätere Hauslehrer Heinrichs, Palma Cayet, schrieb, als Heinrich schon König von Frankreich war, seine Biographie, und daher stammt der Bericht vom Opa und von seiner rauen Erziehung. Dieser Kindheitsbericht ist eher Propaganda des Königs, wie er gerne gesehen werden möchte.
Tatsächlich kam Heinrich in die Obhut der Familie de Miossens, die auf dem Schloss Coarraze wohnte. Die Frau, Suzanne de Bourbon-Miossens, war eine Cousine von Jeanne. Heinrich wurde demnach genau wie seine Mutter als Landadliger erzogen, und er wuchs in einer Familie mit anderen Söhnen auf, die als Erwachsene seine Gefolgsleute werden sollten. Als seine Mutter den Thron erbte, wurde er schon als Kleinkind als Kronprinz behandelt.
Die zwei Jahre zwischen Heinrichs Geburt 1553 und ihre Thronbesteigung 1555 verbrachte Jeanne wiederum in Nordfrankreich in der Nähe ihres Gatten. In dieser Zeit gebar sie einen dritten Jungen, der jedoch nicht lange lebte. Es muss hinzugefügt werden, dass Anton von Bourbon 1554 einen außerehelichen Sohn, Karl von Bourbon, mit einer Hofdame bekam. Jeanne hatte bereits mehrere Onkel, die illegitim waren, und sie scheint den kleinen Karl in ihrer Familie aufgenommen zu haben. Er wurde später Erzbischof von Rouen.
Erst als der Vater gestorben war, zog sie als Königin nach Pau und obwohl sie die Erbin war, ließ sich ihr Mann als König huldigen, was die Ständeversammlung eigentlich gar nicht wollte, dennoch ordneten sie sich dem Willen Jeannes unter.
Königin an der Seite von Anton von Bourbon (1555–1560)
Ihr Vater hatte Jeanne ein blühendes Land hinterlassen. Er hatte Industrien nach Béarn geholt, das Steuersystem effektiv gestaltet und für den religiösen Frieden gesorgt. Große Einkünfte entstanden auch durch seine Posten als Gouverneur und Admiral der französischen Krone in Guyenne. Anton von Bourbon bekam diese Posten nach seinem verstorbenen Schwiegervater, und später hat sein Sohn, Heinrich von Navarra, sie übernommen. Jeanne und Antoine standen als die größten Grundbesitzer Südwestfrankreichs finanziell sehr gut da.
1555 find Calvin seine missionarische Tätigkeit in Frankreich an. Reformierte gab es in Südwestfrankreich zu diesem Zeitpunkt längst, weil Margareta von Navarra sie mit Predigern unterstützt hatte und Gérard Roussel, einen Reformkatholiken, als Bischof in Orthez, eingesetzt hatte. Dieser Roussel war einmal Weggefährte Calvins gewesen, und dieser warf ihm vor, nicht konsequent genug zu sein, als er die Stelle als katholischer Bischof trotz seiner reformatorischen Sympathien annahm (CStA I,1).
Als Königin hatte Jeanne bei ihrer Krönung versprechen müssen, die katholische Religion zu verteidigen. Am selben Tag, nachdem sie diesen feierlichen Eid abgelegt hatte, schrieb sie an einen Vasallen, dem vicomte von Gourdon, und erzählte ihm, sie wolle über die Förderung des reformierten Glaubens im kleinem Kreis heimlich beraten. Dieser Brief ist Teil eines Briefwechsels mit zwei vicomtes de Gourdon, Vater und Sohn, die die gesamte Regierungszeit Jeannes überdauerte. Die Briefsammlung wurde im vorigen Jahrhundert entdeckt und gibt viele neue Einsichten in die Vorhaben und die Beweggründe Jeannes. Da die entdeckten Briefe uns nur als teilweise fehlerhafte Kopien vorliegen, haben viele Forscher die Briefe als Fälschungen abgetan (Text und Diskussion bei Bryson).
Der erste Brief vom August 1555 teilt uns mit, dass Jeanne schon zu diesem Zeitpunkt reformierte Sympathien deutlich aussprach. Sie schrieb dem vicomte, dass ihre Mutter sich zwischen den zwei Religionen nicht habe entscheiden können, und dass sie selbst aus Furcht vor ihrem Vater bislang nicht gewagt habe, sich offen zum Protestantismus zu bekennen. Das Edikt von Chateaubriant von 1551 verbot eindeutig jede „Ketzerei“ und deshalb schlug sie vor, die Reformierten sollten sich heimlich auf dem Schloss Odos treffen.
Es gibt sonst keine Quellen, die belegen könnten, dass Jeanne mit dem reformierten Glauben in Berührung kam. Es gab in ganz Frankreich zu der Zeit kleine zerstreute Gemeinden, sowie Prediger und Kolporteure, die reformatorische Bücher schmuggelten. Die wiederholten Verbote des Königs konnten das nicht unterbinden, sie führten nur dazu, dass Protestanten, wie Jeanne, sich heimlich treffen mussten.
In den Jahren nach 1555 verbreitete sich der reformierte Glaube mehr und mehr im Hochadel. Auch Anton von Bourbon wurde davon ergriffen, brachte reformierte Prediger nach Béarn und als er und Jeanne 1558 mit Heinrich nach Paris zogen, nahm er an großen psalmensingenden Demonstrationen außerhalb der Stadtmauern von Paris teil. Calvin war darüber hoch erfreut, denn er setzte in seiner Missionsarbeit gerne auf hochrangige Persönlichkeiten. Jeanne dagegen verhielt sich während dieser Zeit bedeckt.
In Paris kam sie mit ihrem vierten Kind, einer Tochter namens Katharina, nieder. Das kleine Mädchen war das einzige Kind, das bei Jeanne aufwachsen durfte, obwohl sie (natürlich) Erzieherinnen und Gouvernanten hatte.
Anton von Bourbon fiel nicht nur mit protestantischen Sympathien auf, sondern wie sein Schwiegervater versuchte er, den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. Heinrich d´Albret hatte seinen Besitz gut und gewinnbringend regiert, während Anton von Bourbon seiner Frau die Regierungsgeschäfte überließ, und selbst nur versuchte, ein größeres Königsreich für sich zu gewinnen. So konnte der spanische König Philipp ihm einen Tausch, erst mit dem Herzogtum Milano und später mit Sardinien, anbieten. Damit hätte Spanien den Sprung über die Pyrenäen geschafft und Südfrankreich bedrohen können. Wir würden solches Taktieren mit dem Feind Hochverrat nennen, damals räumte man freilich Adligen große Freiheiten ein, sich einen Herren auszusuchen, aber Anton von Bourbon wurde auch von den Zeitgenossen als unzuverlässig und unverantwortlich angesehen, und nicht zuletzt war er so politisch ungeschickt, dass es an Dummheit grenzte (Sutherland 1984).
Im Sommer 1559 starb Heinrich II. von Frankreich unerwartet. Sein Sohn Franz II. folgte ihm als nur fünfzehnjähriger Knabe auf dem Thron. In dieser Situation war die traditionelle Lösung, dass der erste erwachsene Erbprinz, Anton von Bourbon, ihn unterstützen sollte, und Calvin ermahnte ihn eindringlich, dieses Amt zu übernehmen und dabei den Hugenotten zu helfen. Anton von Bourbon verspielte diese Chance und überließ die Regierungsgeschäfte der Familie von Guise, besonders dem Herzog von Guise und dem Kardinal von Lorraine, die beide die antiketzerische Politik des verstorbenen Königs weiterführen wollten. Nach dem Tod Heinrichs II. bekannten sich mehrere hochrangige Adlige offen zum Protestantismus und es gab im März 1560 sogar einen hugenottischen Komplott, den König zu entführen und von seinen „schlechten Ratgebern“ zu trennen. Anton von Bourbon und sein jüngerer Bruder, der Prinz von Condé, beide notorische Reformierte, wurden wegen diesem Angriff auf den König angeklagt. Anton von Bourbon versprach Besserung, während sein Bruder, der Prinz Ludwig von Condé zum Tode verurteilt wurde. Nur der plötzliche Tod des jungen Königs rettete ihn vor der Hinrichtung. Da der neue König, Karl IX., ein zehnjähriges Kind war, brauchte Frankreich einen Regenten, nämlich den ranghöchsten Erbprinz Anton von Bourbon. Wiederum ergriff dieser nicht die Chance. Katharina von Medici ließ sich stattdessen als Regentin einsetzen und Anton von Bourbon wurde zum Generalstatthalter ernannt. Die Hugenotten mit Calvin an der Spitze waren zutiefst enttäuscht. In diesen Jahren hatte der reformierte Glaube großen Zulauf, es wurde von mehreren Tausend Gottesdienstbesuchern überall in Frankreich berichtet, von Abendmahlgottesdiensten, die zwei Tage dauerten und von Bekehrungen am Hof und im Hochadel.
1560 verließ Jeanne Paris, um zurück nach Pau zu fahren. Theodorus Beza, der engste Mitarbeiter Calvins, besuchte sie dort, und es entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit, die bis Jeannes Tod dauerte. Beza versorgte sie mit Predigern und Beratern für ihr Land. Im Dezember 1560 unternahm Jeanne den entscheidenden Schritt und bekehrte sich öffentlich zum reformierten Glauben. Während ihr Gatte nicht in der Lage war, sich an die Spitze der Hugenotten zu setzen, wurde sie jetzt die leitende Hugenottin in Frankreich.
Reformierte Königin (1560–1568)
Jeanne d´Albret war zweifelsohne eine tief religiöse Frau. Lange Zeit hatte sie äußerste Diskretion walten lassen, zwar mit ihrem Gatten reformierte Prediger gehört, aber sich niemals offen zum reformierten Glauben bekannt. Erst nachdem Anton von Bourbon sich mit dem Posten als lieutenant générale abgefunden hatte, kam sie aus der Deckung.
Es war eine Zeit, wo alle große Hoffnungen bzw. Ängste für den Protestantismus in Frankreich hegten. Drei wichtige Katholiken – der Herzog von Guise, der Konstabel von Montmorency und der Marschall St. André – schlossen sich zusammen, um Frankreich gegen die Reformierten zu schützen. Sie planten den Sturz von Anton von Bourbon und einen Angriff auf Genf mit der Hilfe des Herzogs von Savoyen, zu dessen Besitz Genf bis 1534 gehört hatte. Dieses Triumvirat war der erste Vorbote der katholischen Liga, die später Heinrich IV. hartnäckig bekämpfte (Sutherland 1973).
1560 war noch zu erwarten, dass der Protestantismus nach Frankreich gekommen war, um zu bleiben. Jeanne war sich sehr bewusst, welche Gefahren ihr von Spanien, vom Papst und von der mächtigen Familie von Guise drohten. Sie hatte noch die Hoffnung, dass der junge König Karl IX., Katharina von Medici und ihr Kanzler, der tolerante Michel de l´Hôpital, die Reformierten unterstützen würden, zumal die Königinmutter sich selbst von denen von Guise bedrängt fühlte.
Diese letzte Hoffnung erwies sich als trügerisch, aber niemals wich Jeanne später vom einmal eingeschlagenen Kurs ab. Sie konnte weder geldwerte Vorteile noch politisches Kapital aus ihren Glauben schlagen, dafür hielt sie konsequent an ihrer Überzeugung fest.
In Béarn machte sie erste vorsichtige Schritte, um das Land zu reformieren. Es gab schon Reformierte dort, und Prediger hatten angefangen, den neuen Glauben zu verbreiten, Jeanne aber träumte von einem reformierten Land, und fing langsam und vorsichtig an, diesen Traum zu verwirklichen.
Der erste Schritt war, den reformierten Glauben dem Katholizismus rechtlich gleich zu stellen. Die Kirchen wurden für beide Religionen geöffnet (das sogenannte simultaneum) und aus den Kirchen in Lescar und Pau wurden Bilder und Statuen entfernt, allerdings nicht in Form eines Bildersturms, sondern von den Behörden. Jeanne beschlagnahmte das kirchliche Vermögen nicht für sich selbst, sondern investierte es in Sozialfürsorge und Bildung.
Es ist klar, dass sie den reformierten Glauben einführen wollte, aber zu keinem Zeitpunkt vefolgte sie Andersgläubige, geschweige denn verbrannte sie. Immer setzte sie auf Überredung.
Im August 1561 begab sie sich wieder zum Hof. Überall wurde sie stürmisch von Hugenotten begrüßt, als ob sie „der Messias sei“, bemerkte verärgert der spanische Gesandte. Katharina von Medici hatte zu einem Religionsgespräch eingeladen. Dieses Gespräch fand in Poissy außerhalb Paris statt. Seitens der Krone war gewiss an eine Versöhnung oder gar einen Ausgleich zwischen den Religionen gedacht, die reformierten Teilnehmer mit Beza an der Spitze mochten jedoch keine Kompromisse eingehen. Beza wurde unterstützt von Calvin in Genf, der selbst zu krank war, um mitzukommen. Calvin war mit den Auftritten und Reden Bezas zufrieden, während z.B. der Admiral Coligny Beza als reichlich provokant wahrnahm.
Im Herbst 1562 blieb Jeanne mit ihren Kindern beim Hofe. Katharina von Medici suchte auch nach den Religionsgesprächen eine Übereinkunft mit den Protestanten, was in dem Edikt vom 17. Januar 1562 – auch Edikt von St. Germain genannt – gipfelte. Dieses Edikt, an dem der Kanzler Michel de l´Hôpital und Beza beteiligt waren, erlaubte es den Hugenotten, außerhalb der Städte Gottesdienste zu halten. Es war das günstigste Edikt, das sie jemals erlangen sollten, das Edikt von Nantes 1598 war ihm sehr ähnlich, aber nicht ganz so großzügig. Der Unterschied war, dass Heinrich IV. dafür sorgte, dass das Edikt von Nantes durchgeführt wurde, während alle frühere Edikte, so wohlgemeint sie auf dem Papier auch waren, von katholischen Behörden unterlaufen wurden, und der König zu schwach war, um für ihre Durchführung zu sorgen.
Im März 1562 massakrierte der Herzog von Guise eine reformierte Gemeinde, die innerhalb des Städtchens Wassy Gottesdienst feierte. Damit war die Versöhnungspolitik Katharinas von Medici gescheitert. Die Hugenotten unter dem Prinzen von Condé griffen zu den Waffen und Anton von Bourbon bat Jeanne den Hof zu verlassen. Er behielt seinen Sohn Heinrich bei sich, entließ aber dessen hugenottischen Hauslehrer. Jeanne beschwor ihren Sohn, nicht zur Messe zu gehen, und der junge Prinz hielt sich wohl auch ein paar Wochen daran, musste sich aber schließlich fügen. Nach ihrem Fortgang vom Hofe trat Jeanne eine monatelange abenteuerliche Reise durch Frankreich an, so gefährlich, dass die ersten Briefen von der Hand Heinrichs seine Ängste um seine Mutter bezeugen. Ihre kleine Tochter Katharina durfte sie behalten.
Im ersten Religionskrieg führte Anton von Bourbon die königlichen katholischen Truppen gegen die Hugenotten. Bei der Belagerung von Rouen wurde er verwundet und starb am 17. November. Der junge Heinrich blieb am Hofe in der Obhut Katharinas von Medici, die allerdings Jeanne gestattete, ihm wieder reformierte Hauslehrer zu geben. Sie sollte ihn erst 1564 wiedersehen.
Die Kirche in Béarn und Navarra
Ihre große Aufgabe sah Jeanne darin, die Reformation in Béarn durchzuführen.
Calvin stellte ihr Jean Raymond Merlin zur Seite, den früheren Professor für Hebräisch in Lausanne, wo er Kollege von Beza, dem Professor für Griechisch, und von Pierre Viret, dem Rektor der Akademie, gewesen war. Pierre Viret arbeitete nach seiner Zeit in Lausanne und Genf vor allem in Frankreich, besonders in den Kirchen von Lyons und Nîmes. Später sollte er für Jeanne d´Albret ihre Akademie in Orthez aufbauen. Merlin war übrigens mit einer Tochter von Marie Dentière verheiratet, derjenigen, die vor Jahren Jeanne eine selbstgeschriebene hebräische Grammatik zugesandt hatte (vgl. Graesslé13f.; Nielsen).
Merlin ging voll Eifer an die Aufgabe, eine reformierte Kirche in Béarn aufzubauen. Es gab viele Reformierte in Südfrankreich, aber meistens unter städtischen Eliten und Handwerkern. Die Reformierten waren meistens des Lesens fähig, vor allem des Lesen französischer Texte. In Südwestfrankreich sprach die Bevölkerung die langue d´oc, die alte oczitanische Sprache, in irgendeiner Form. Die Gascogne hatte ihre Sprache, in der ein Neues Testament und fünfzig Psalmen übersetzt wurden, und Béarn hatte béarnais sogar als Amtssprache. Hinzu kam, dass die Bevölkerung in Navarra Baskisch sprach. Wenn Merlin das ganze Land reformieren sollte, musste er diese Sprachbarrieren überwinden, denn die Landbevölkerung musste erreicht und für die Reformation gewonnen werden.
Jeanne d´Albret beauftragte eine Übersetzung des Neuen Testaments ins Baskische, und eine Übertragung der Psalmen, der Zehn Gebote, der Liturgie und des Katechismus Calvins in die Sprache Béarns. Der Anwalt, später Pastor, Arnaud de la Salette, stellte 1571 diese Übersetzung fertig, und obwohl sie erst 1583 gedruckt wurde, darf man annehmen, dass in der Zwischenzeit Manuskriptkopien verwendet wurden. Pastoren, die die béarnesische oder die baskische Sprache beherrschten, wurde händeringend gesucht, und von den Anderen wurde ausdrücklich verlangt, dass sie es lernen sollten. Katecheten, die vermutlich Landeskinder waren, wurden in die Gemeinden geschickt.
Allmählich verbot Jeanne katholische Riten und Gebräuche, zuerst die Fronleichnamsprozessionen, danach Maibäume und Jahrmärkte. Dann wurde die Messe abgeschafft. Der Dom von Lescar und die Kirche St. Martin in Pau wurden leergeräumt, und die dort befindlichen Schätze verkauft.
Für Merlin konnte dies nicht schnell genug gehen. In seinen Briefen an Calvin klagte er seine Not: die Bevölkerung sei stur – diese Holzköpfe! - und die Königin zu langsam und vorsichtig (CO 20, Nr. 3988 & Nr. 4061). Merlin hatte übrigens auch früher in Montargis Probleme mit Renée de France gehabt, Herzogin von Ferrara, die in ihrem Gebiet so vorsichtig war wie Jeanne in Béarn (vgl. Lambin, 2). Jeanne bekam Klagen auf der jährlichen Ständeversammlung, wo die Katholiken über den Verlust alter Freiheiten und Rechte klagten. In den sechziger Jahren musste sie mehrmals Aufstände niederschlagen.
Der Nachfolger für Merlin war Pierre Viret, der enge Freund Calvins. Er war Pastor und Rektor für die Akademie in Lausanne – mit Beza und Merlin als Kollegen – gewesen. Wegen eines Streits mit dem Stadtrat in Bern, übersiedelten 1559 alle Professoren nach Genf, um dort in der neu errichteten Akademie zu unterrichten. Von Genf begab Viret sich nach Frankreich, wo er in Lyon als Pastor arbeitete, danach leitete er die Nationalsynode in Nîmes und schließlich folgte er dem Ruf nach Béarn. Seine wesentlichste Aufgabe war es, die Akademie in Orthez aufzubauen. Die Fächer Theologie, Hebräisch, Griechisch, Philosophie und Mathematik wurden dort unterrichtet, während es keine Anzeigen für Professuren in Jura und Medizin gibt.
Vor ihrer akademischen Laufbahn absolvierten die Jungen eine fünfjährigen Ausbildung in einer Lateinschule (collège), während die Grundschule sowohl Jungen wie Mädchen unterrichtete, die Mädchen allerdings getrennt mit weiblichen Lehrkräften. Damit wurde das kleine Béarn das erste Land Europas, welches kostenlosen Unterricht für Mädchen zusicherte, und zwar mit der interessanten Begründung, dass sie so im Stande waren, ihr Brot zu verdienen und sich der Gesellschaft nützlich zu machen („Pareil rolle sera aussy faict des filles qui sont en bas aage et qui n´ont nul moyen de vivre et de s´entretenir, par toutes les églises, afin que de mesmes deniers et en écolle séparée elles soient enseignées, nourries et tenues par des femmes sages et pudiques, par leur industrie pouvoir aprés se nourrir et entretenir et servir au public“. Art. 32 der Verfassung der Akademie von 1566, zitiert nach Desplat 2004). Desplat unterstreicht die säkulare Ausrichtung der Ausbildung. Allgemein wird behauptet, der Zweck des Unterrichts in protestantischen Ländern sei, die Bevölkerung des Lesens der Bibel und des Katechismus zu befähigen. Hier werden nur die Vorteile eines Schulunterrichts für die Gesellschaft betont.
Die Akademie wurde 1566 geöffnet. Die ersten protestantischen Akademiegründungen in Frankreich fanden in Nîmes (1562) und Montpellier statt. Vorrangiges Ziel war es, die Kirchen mit Pastoren zu versorgen, da die Akademie in Genf die steigende Nachfrage der Gemeinden kaum nachkommen konnte. Da Papst Pius V. die katholischen Universitäten angewiesen hatte, Protestanten die Abschlüsse zu verweigern (Maag 2002, 140), brauchten junge Hugenotten ihre eigenen Universitäten, die dann auch gegründet wurden, vor allem in Leiden und Heidelberg, aber auch in Frankreich und benachbarten Gebieten wie Béarn, Orange und Sedan, die alle zu diesem Zeitpunkt unabhängig waren.
Jeanne hatte sehr gute Gründe, langsam und überlegt vorzugehen. Der Kardinal von Armagnac ließ sie wissen, dass sie die Bevölkerung Béarns in Ruhe lassen sollte, ihre Untertanen wollten ihren Katholizismus nicht aufgeben. Jeanne antwortete, dass sie in Béarn nur Gott über sich habe, dort könne sie ihrem Gewissen folgen, und in ihrem Land werde niemand wegen seines Glaubens verfolgt. Das letzte war ihr ein Anliegen, denn 1571 schrieb sie an ihren Statthalter, den Baron d´Arros, dass in ihrem Land niemand zum Glauben je gezwungen worden war und es auch nicht werden sollte („...intention n´a point esté et n´est encores qu´ilz soyent contraints par force et violence de se reanger à ladite Religion“, d´Aas 2002, 452).
Als sie sich bei der Einführung der Reformation in ihren Ländern unnachgiebig zeigte, zitierte der Papst sie nach Rom zwecks eines Ketzerprozesses. Da sie dieser Einladung nicht folgte, exkommunizierte er sie. Der Bann war eine ernste Bedrohung, da jeder katholische Herrscher jetzt das Recht hatte, ihre Länder an sich zu reißen und sie abzusetzen, eine Chance, die Philipp II. von Spanien sich nicht entgehen lassen würde. Katharina von Medici verteidigte deshalb Jeanne, weil sie keine spanische Präsenz auf der französischen Seite der Pyrenäen dulden wollte. Außerdem war sie eine Verfechterin der gallikanischen Freiheit der französischen Kirche und meinte deshalb, der Papst solle sich nicht in die Angelegenheiten der Kirche einmischen.
Königin der Hugenotten
Nach dem ersten Religionskrieg (1562-63) ließ Katharina von Medici den jungen Karl IX. mündig erklären und führte ihn mit dem Hof auf eine große Frankreichreise, die mehrere Jahre dauerte. Der Zweck dieser Reise war es, den König dem Volk zu zeigen, und damit die Loyalität der Bevölkerung zu erhalten. Jeanne wurde als Vasallin einberufen und stieß Ende Mai 1564 zum Zug in Macon.
Ihr Sohn Heinrich nahm auch Teil an diese Reise und seinetwegen stritten die zwei Königinnen sich, weil Jeanne ihn bei ihren protestantischen Gottesdiensten dabei haben wollte, und Katharina wünschte, dass er mit der königlichen Familie zur Messe gehe. Schließlich sandte Karl IX. Jeanne zu ihrem Besitz in Vendôme, während Heinrich als Gouverneur von Guyenne den Zug begleitete und in den Städten für den feierlichen Empfang des Königs sorgte.
Jeanne durfte nicht mit nach Bayonne, wo Katharina ihrer Tochter Elizabeth, Königin von Spanien, begegnen wollte. Philipp II. sandte als seinen Gesandten den Herzog von Alba, der auf dem Weg in die Niederlande war. Die Hugenotten waren später überzeugt, dass Alba und die Königinmutter in Bayonne ihre Ausrottung geplant hatten. Sicher ist, dass Alba in den Niederlanden mit aller Härte gegen die Protestanten vorging, und es ist durchaus möglich, dass er versuchte, Katharina auf seinen mörderischen Kurs einzustimmen. Schon 1568 – also vor der Bartholomäusnacht! – schrieb Jeanne, dass die Waffen, die gegen die Hugenotten verwendet werden sollten, in Bayonne geschmiedet worden seien (Ample déclaration).
Jeanne und Heinrich trafen sich später in Paris. 1566 ersuchte sie erneut um Erlaubnis, mit ihren beiden Kindern nach Béarn zu fahren, was ausgeschlagen wurde. Sie erhielt aber Erlaubnis, ihren Sohn in seinen französischen Ländereien herumzuführen, und Anfang 1567 reiste sie dann mit ihm nach Vendôme, und von dort setzte sie sich unerlaubt ab nach Béarn. Damit machte sie laut des Biographen Heinrichs, Pierre Babelon, aus einem französischen Prinzen einen Ausländer, und vor allem einen Hugenotten.
Von 1567 an arbeitete Jeanne für die Zukunft ihres Sohnes. Ihre Lebensaufgabe, schrieb sie selbst, sei: Gott, Königtum und ihr Blut. Mit Gott war die reformierte Religion, die wahre Kirche Gottes, gemeint. Mit dem König ihr Status als Vasallin und – trotz Béarn – als Französin, und mit dem „Blut“, die Familie, zuallererst ihr Sohn Heinrich. Er sollte von jetzt an kein Höfling mehr sein, sondern die Aufgaben eines Regenten lernen. Als ein Aufstand in Navarra niedergeschlagen worden war, wurde er dorthin geschickt, um die Basken zu befrieden. Als 14jähriger hielt er für seine Untertanen eine Rede, in welcher er ihr Fehlverhalten geißelte, ihnen die Gunst der Königin zusicherte, falls sie sich verbessern würden, und seinen berühmten Charme mit seinem Autoritätsanspruch verband.
Im Herbst 1567 versuchten die Hugenotten, die sich von der Aufrüstung des Königs bedroht fühlten, Karl IX. in ihre Gewalt zu bringen. Die Entführung missglückte, und die königliche Familie suchte, beschützt von den schweizerischen Söldnern, die die Ängste der Hugenotten verursacht hatten, Zuflucht in Paris. Die Hugenotten belagerten die Stadt. Im November wurden sie vor den Toren von St. Denis geschlagen und mussten sich in die Provinz zurückziehen, wo sie den Kampf bis zum Friedenschluss von Longjumeau im März 1568 fortsetzen.
Der Friedensvertrag war an sich nicht ungünstig für die Hugenotten, nur haperte es wie immer mit der Umsetzung. Katholische Behörden waren über die für die Hugenotten günstigen Bedingungen empört und setzten sie nicht um. Der Protestant La Noue schrieb in seinen Erinnerungen, dass der Krieg zwar viel Unheil bringe, aber dieser elende kleine Friedensvertrag sei viel schlimmer für die Reformierten, die in ihren Häuser umgebracht wurden, ohne dass sie sich zu wehren wagten („ …une guerre est misérable et qu´elle apporte avec soy beaucoup des maux…cette méchante petite paix est beaucoup pire pour ceux de la Réligion, qu´on assassinoit en leur maisons, et ne s´osoyent encores défendre“, d´Aas 2002, 382) Im Laufe des Sommers 1568 versuchten die Gruppierungen noch einmal miteinander zu reden, Karl IX. sandte einen Botschafter nach Béarn, und Jeanne verfasste ein Sendschreiben an den König mit dem Antrag, den Frieden in Guyenne wiederherzustellen.
In der Zwischenzeit fühlten sich der Prinz von Condé und der Admiral Coligny auf ihre Schlösser in Bourgogne zunehmend bedroht. Der Herzog von Alba wollte in den Niederlanden mit Feuer und Schwert den Protestantismus auszurotten, und Flüchtlinge berichteten ihnen von seinem Terror. Am 23. August 1568 flüchteten sie mit ihren Familien und Angehörigen über die Loire nach La Rochelle. Die Überquerung der Loire erinnerte fast an den biblischen Durchzug durchs Schilfmeer: so viele Hugenotten hatten sich angeschlossen, dass der Zug fast wie eine Völkerwanderung aussah, und die Loire hatte in der Augusthitze einen so niedrigen Wasserstand, dass Sandbanken in der Mitte auftauchten. Dementsprechend sangen alle Psalm 114 vom Auszug der Israeliten aus Ägypten, als sie hinüber waren. Die Parallele wurde noch einmal deutlich, als die königlichen Truppen, die sie verfolgten, wegen plötzlich einsetzenden Hochwassers den Fluss nicht überqueren konnten.
In dieser Situation war Jeanne zutiefst gespalten. Bislang hatte sie die Kriege moralisch unterstützt, aber nicht selbst teilgenommen. Falls es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen sollte, konnte sie immer mit ihren Kindern in der uneinnehmbaren Festung Navarrenx Zuflucht suchen. Sie hatte jedoch ihren Sohn, der als zukünftiger Führer der Hugenotten das Kriegshandwerk lernen sollte, und so musste sie wählen, ob sie in Béarn unter ihrem Volk bleiben oder sich den Hugenotten anschließen sollte: „ich hatte den Krieg im Bauch“ schrieb sie danach („J´eu la guerre en mes entrailles“, Ample declaration). Sie setzte den Baron d´Arros als Statthalter ein, und Anfang September begab sie sich in Eilmarsch nach La Rochelle (Cocula 2004). Dort konnte sie ihren Sohn dem Prinzen von Condé überantworten. Sie schrieb unterwegs eine Reihe Briefe an Karl IX., an Katharina von Medici, an ihren Schwager, den Kardinal von Bourbon und an die Königin Elizabeth von England, um ihren Entschluss zu begründen. Angekommen in La Rochelle schrieb sie eine Erklärung („Ample declaration“) um der Öffentlichkeit zu erklären, warum sie sich der hugenottischen Armee zugesellte.
Die Hugenotten unter ihren Anführer aus der königlichen Familie wollten nicht als Aufrührer dastehen. Sie behaupteten, die erzkatholische Partei sei schuld daran, dass königliche Befehle nicht vollzogen wurden. Die Katholiken mit ihren Verbindungen nach Spanien und Rom seien Landesverräter. Die Politik des Kardinals von Lorraine verdient laut Sutherland (1974) keinen anderer Namen. Wenn Jeanne vom Frieden sprach, meinte sie eine Duldung der Hugenotten in Frankreich. Die Forderungen der Hugenotten waren immer dieselbe: Erlaubnis, Gottesdienste zu feiern, Gerichte mit zur Hälfte hugenottischen Richtern, sichere Zufluchtsstädte – deren Anzahl schwankte in den Verhandlungen – und Zugang zu Ausbildung und Beamtenstellen gleichrangig mit den Katholiken. Die Provinz Languedoc unter dem moderat katholischen Gouverneur Montmorency-Damville war ein friedlicher Ort in den Religionskriegen, weil Damville den Hugenotten solche Rechte einräumte, und die katholische Bevölkerung sich damit abfand.
Im März 1569 fand eine Schlacht bei Jarnac statt. Der Prinz von Condé kämpfte mit, wurde verwundet und nach der Schlacht ermordet. Es gelang Admiral Coligny, die hugenottischen Truppen zusammenzuhalten, aber der Verlust des Prinzen war ein herber Schlag. Heinrich von Navarra war jetzt der ranghöchste Prinz, und zusammen mit seinem Vetter, dem gleichaltrigen Heinrich von Condé, wurde er jetzt Oberbefehlshaber über die Armee der Prinzen. In Wirklichkeit lag die Verantwortung für die Kriegsführung bei dem erfahrenen Admiral, und die beiden Prinzen wurden seine Pagen genannt.
Jeanne blieb in La Rochelle, während Coligny mit den Prinzen im Krieg war, und sie konnte, unterstützt von einem Rat adliger Hugenotten, die „Regierungsgeschäfte“ regeln. Sie schrieb an England und nach Deutschland. Sie unterzeichnete Erlässe, versuchte Geld für das Heer aufzutreiben, pfändete ihren schönsten Schmuck für einen Kriegsdarlehen an Elizabeth von England und ließ ein Kriegsschiff namens „Die Hugenottin“ bauen.
So wie sie immer behauptete, nicht gegen den König, sondern gegen seine schlechten Ratgeber zu kämpfen, so behauptete Karl IX., dass sie in La Rochelle von den Hugenotten gefangen gehalten wurde, und er ließ den Baron Terride mit einer „Befreiungsarmee“ in Béarn einfallen. In kürzester Zeit waren ganz Béarn und Navarra erobert und zum Katholizismus zurückgeführt. Nur der Baron d`Arros hielt im Navarrenx stand. Um ihre Länder zurückzuerobern, sandte Jeanne den Graf von Montgommery mit einer „Hilfsarmee“ nach Navarrenx. In noch kürzerer Zeit als Terride gebraucht hatte, verjagte er ihn aus Béarn. Die Befreiung von Terride wurde in Pau mit einem Festgottesdienst gefeiert, wobei Pierre Viret über Psalm 124, 7: „Unsere Seele ist aus dem Netz des Vogelfängers entkommen“ predigte.
Vom Winter 1569 bis zum Frühjahr 1570 führte Coligny sein Heer mit den Prinzen Heinrich von Navarra und Heinrich von Condé durch ganz Südfrankreich und von Provence nach Norden, bis er Paris bedrohte. Der König hatte kein Geld mehr, um Krieg zu führen, und musste notgedrungen Friedensverhandlungen einleiten. Im August 1570 wurde dann der Frieden von St. Germain geschlossen. Wiederum war Jeanne d´Albret diejenige, die auf Augenhöhe mit dem König verhandeln konnte. Der Vertragstext erklärt immer wieder, dass der König die Bedingungen seiner Tante erfüllen wollte (Sutherland 1980, Potter 1997).
Jeanne blieb vorläufig in La Rochelle. Im April 1571 fand dort die Nationalsynode der reformierten Kirchen Frankreichs statt. Theodor Beza kam aus Genf angereist, um die Synode zu leiten. Pierre Viret wollte teilnehmen, starb aber vorher, vermutlich hatte seine Gesundheit in der Gefangenschaft unter Baron Terride gelitten. Auf der Synode wurde das französische Glaubensbekenntnis von 1559 neu verhandelt und die endgültige Fassung als „Bekenntnis von La Rochelle“ beschlossen. Darüber hinaus wurde eine Kirchenordnung für Béarn beschlossen, und die Synode diskutierte Fragen, die Jeanne d´Albret gestellt hatte. Als Ersatz für Pierre Viret bekam sie Nicolas des Gallars zur Seite gestellt. Er war Calvins Sekretär gewesen, danach hatte er die „Strangers´ Church“, die Kirche für Ausländer in London, als Nachfolger für Johannes à Lasco geleitet und dann an Bezas Seite im Colloquium von Poissy 1561 gestanden. Er war Pastor in Orléans gewesen und wurde jetzt Seelsorger für Jeanne d´Albret und ihr theologischer Ratgeber für die Kirche in ihrem Land.
Er war eine gute Wahl, denn während Beza sehr an dem Konzept von Genf hing und ein presbyteriales Kirchenverständnis (Kingdon 1967) hatte, war des Gallars in England gewesen, als Königin Elizabeth nach dem Tod ihrer katholischen Schwester die anglikanische Kirche einführte. Außerdem behauptet Bernard Roussel (2004), dass er das Buch Martin Bucers „De regno Christi“ von 1550 mitbrachte. Dieses Buch ist dem englischen König Edward VI. gewidmet und beschreibt, wie ein König eine reformierte Kirche leiten kann. Damit hatte des Gallars ein Konzept für eine von einer Fürstin geleitete Kirche, die dann in den Jahren als Heinrich und Katharina von Navarra das Erbe der Mutter verwalteten, Bestand hatte.
Während Jeanne in La Rochelle noch weilte, ereilte sie ein Angebot von Katharina von Medici, ob ihren Sohn Heinrich die Tochter Katharinas heiraten mochte. Hugenotten und Katholiken würden sich versöhnen und die Häuser Valois und Bourbon sich nahekommen. Dieses Angebot war zu verlockend, um es auszuschlagen, aber Jeanne traute Katharina nicht so recht, jedenfalls wollte sie nicht gleich nach Paris ziehen, um über die Ehe zu verhandeln.
Stattdessen fuhr sie nach Pau zurück, führte die neu beschlossene Kirchenordnung ein und kümmerte sich um ihre Länder. Die Tuberkulose machte sich bemerkbar und sie wollte zur Kur in die Bergen fahren. Währenddessen zogen sich die Eheverhandlungen hin, bis Jeanne endlich im Frühjahr 1572 nach Paris zog. In den Briefen an ihren Sohn hört man von den Verhandlungen, von ihrer Missbilligung des höfischen Lebens und von ihrem Ärger mit Katharina. Jeanne wollte so viele Rechte wie möglich für ihren Sohn und die Hugenotten aushandeln. Am Ende musste sie es aufgeben, Margareta von Valois, Margot genannt, zum reformierten Glauben zu bekehren. Dafür hoffte sie aber, dass das Brautpaar nach Béarn ziehen würde. Eine königliche Mischehe war etwas ganz Neues und musste in Detail besprochen und geplant werden. Jeanne handelte das Meistmögliche für ihren Sohn aus und im April 1572 wurde eine Einigung erzielt. Heinrich sollte allerdings noch eine Weile in Béarn bleiben und Jeanne bereitete in Paris die Hochzeit vor.
Die zähen Verhandlungen im Frühjahr hatten viel Kraft gekostet, Jeanne hielt sich aber tapfer. Im Juni brach sie zusammen und starb am 9. Juni an der Tuberkulose, die sie seit Jahren geplagt hatte. Später entstanden Gerüchte, sie sei von Katharina von Medici vergiftet worden. Diese sollte ihr ein Paar Handschuhe, die von ihrem privaten Giftmischer präpariert worden seien, geschenkt haben. Da Katharina nach den Massakern von St. Bartholomäus, die in der Periode von August bis November 1572 stattfanden, von den Hugenotten als der Inbegriff des Bösen dargestellt wurde, gehört der Giftmord an Jeanne d´Albret zu den Verleumdungen.
Heinrich traf erst etwas später in Paris ein. Im Testament Jeannes hatte sie sich gewünscht, in Béarn bei ihrem Vater beerdigt zu werden. Ihr Sohn setzte sich über ihren letzten Willen hinweg: sie wurde nach Vendôme geführt und neben ihrem Mann, Anton von Bourbon, bestattet.
Trotz ihre Fähigkeiten wurde sie eine Fußnote in der Geschichte Frankreichs: ihr Sohn wurde zwar als Heinrich IV. König von Frankreich, aber er wurde katholisch und aus den Hugenotten wurde, dank des Ediktes von Nantes 1598, eine geduldete Minderheit. Die Kirche, die Jeanne in Béarn aufgebaut hatte, wurde unter ihrem Enkelsohn, Ludwig XIII., verboten. 1685 wurde dann das Edikt von Nantes aufgehoben, und die Reformierten wurden grausam verfolgt. Viele flüchteten, viele konvertierten und viele wurden umgebracht. Die großen Hoffnungen, die die Hugenotten um Jahr 1560, als Jeanne konvertierte, hegten, erwiesen sich als trügerisch.
Wenn auch letztlich nicht erfolgreich, war sie dennoch bewundernswert. Mit dem Admiral Coligny zusammen hatte sie den Frieden von St. Germain errungen, dann eine Landeskirche aufgebaut und ihre Kinder gefördert. Sie war die reformierte Präsenz in der königlichen Familie und in ihren letzten Jahren wurde sie die Königin der Hugenotten.
Stammtafeln der Familie von Valois und der Familie von Bourbon (PDF)
Literatur
Quellen:
Albret, Jeanne d´: Lettres suivies d´une ample Déclaration, ed. Bernard Berdou d´Aas, Biarritz 2007.
Bordenave, Nicolas de: Histoire du Béarn et de la Navarre, Paris 1873.
Bucer, Martin: De regno Christi: libri duo, 1550, ed. François Wendel, in: Robert Stupperich, Hrsg. Ser. 2, Opera latina Bd. 15,1, Gütersloh 1955. In: Studies in Medieval and Reformation Thought, Leiden 1982. „Du royaume de Jesus Christ“, édition critique de la traduction française de 1558/texte établi par François Wendel, Bd.15,2, Gütersloh 1954.
Calvin, Johannes: Calvini opera quae supersunt omnia (= CO), hrsg.v.W.Baum, E.Kunitz, E.Reuss, 59 Bde, Braunschweig/Berlin 1863-1900.
Calvin-Studienausgabe (= CStA), hrsg.v. E.Busch u.a., Neukirchen-Vluyn ab 1994.
Coudy, Julien, ed.: Die Hugenottenkriege in Augenzeugenberichten, Darmstadt 1965
Potter, David, ed.: The French Wars of religion, Selected Documents, London & New York 1997.
Ruble, Alphonse de: Le mariage de Jeanne d´Albret, Paris 1877.
Ruble, Alphonse de: Antoine de Bourbon et Jeanne d´Albret, Paris 1881, 1882, 1885 & 1886, 4 Bde.
Ruble, Alphonse de: Jeanne d´Albret et la guerre civile, Paris 1897.
Ruble, Alphonse de: Mémoires et poésies de Jeanne d´Albret, Paris 1893, Slatkine Reprints Genf 1970 (online auf Französisch: https://archive.org/details/mmoiresetposies00rublgoog).
Stegman, A.: Les édits des guerres de religion, Paris 1979.
Sekundärliteratur:
Aas, Bernard Berdou d´: Jeanne III d´Albret, Chronique 1528-1572, Anglet 2002.
Actes du colloque “Arnaud de Salette et son temps – Le Béarn sous Jeanne d´Albret”, Orthez 1984 (war mir leider nicht zugänglich).
Actes du colloque “L ´Amiral de Coligny et son Temps”, Paris 1974.
Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Babelon, Pierre: Henri IV, Paris 1982.
Benedict, Philip, ed.: Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585, Amsterdam 1999.
Benedict, Philip: “Confessionalization in France? Critical reflections and new evidence”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Bryson, David: Queen Jeanne and the Promised Land, Dynasty, Homeland, Religion and Violence in Sixteenth Century France, Leiden 1999.
Buisseret, David: Henry IV, London 1984.
Cazaux, Yves: Jeanne d´Albret, Paris 1973.
Cholakian, Patricia F. & Cholakian, Rouben C.: Marguerite of Navarre, Mother of the Renaissance, New York 2006.
Cocula, Anne-Marie: ”Été 1568. Jeanne d´Albret et ses deux enfants sur le chemin de La Rochelle”, Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Desplat, Christian: “Jeanne d´Albret, un modèle d´éducation maternelle?”, in: Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Eurich, Amanda: “Le pays de Canaan”: L´évolution du pastorat béarnais sous Jeanne d´Albret”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Graeslé, Isabelle: Vie et légendes de Marie Dentière, Bulletin du centre protestant d´études, Genéve 2003.
Greengrass, Mark: “The Calvinist experiment in Béarn”, in: A. Pettegree, A. Duke & G. Lewis: Calvinism in Europe 1540 - 1620, Cambridge 1994.
Kingdon, Robert M.: Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement 1564-1572, Genève 1967.
Knecht, R.J.: Catherine de´ Medicis, London 1998.
Kuperty-Tsur, Nadine: “Jeanne d´Albret ou la persuasion par la passion”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Lambin, Rosine: Calvin und die adelige Frauen im französischen Protestantismus, http://www.reformiert-info.de/2304-0-0-20.html
Maag, Karin: “The Huguenot academies: preparing for an uncertain future”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Martin-Ulrich, Claudie: “Récit de vie, récit de mort: Le Brief discours sur la mort de la royne de Navarre, Jeanne d´Albret” in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Mentzer, Raymond A. & Spicer, Andrew, eds.: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Nielsen, Merete: Theologie als Erzählung – erzählte Theologie, Das Heptameron von Margarete von Navarra, http://www.reformiert-info.de/side.php?news_id=5444&part_id=0&navi=4
Nielsen, Merete: Marie Dentière,
Der Held aus Juda siegt mit Macht
Johann Sebastian Bachs Johannespassion – ihre Geschichte – ihre Theologie

1. Anfängliche Hinweise
Fünf große Passionsmusiken soll Johann Sebastian Bach dem kurz nach seinem Tode von seinem Sohn Carl Philip Emanuel und Johann Agricola verfassten Nekrolog nach geschrieben haben. Immer wieder ist diese Angabe in Zweifel gezogen worden. Kennen wir doch nur drei Passionen – genau genommen nur zwei. Wir kennen die Johannespassion und die Matthäuspassion. Aus zuverlässigen Nachrichten und über Parodiebeziehungen kennen wir die Chöre und Arien der verschollenen Markuspassion. Eine teilweise in Bachs Handschrift vorliegende Lukaspassion aus der Weimarer Zeit hat sich längst als das Werk eines anderen herausgestellt. Wo sind die beiden anderen Passionsmusiken, von denen der Nekrolog spricht? Sind sie verschollen, wie die Markuspassion? Verschollen, ohne Spuren zu hinterlassen wie eine vermutete Lukaspassion? – das wäre ungewöhnlich. Irrt der Nekrolog? – auch das ist wenig wahrscheinlich. Es bleibt nur die Möglichkeit, dass sich die verschollenen Passionen in, mit und unter den vorhandenen finden lassen.
In der Tat hat Johann Sebastian Bach sich in seiner Leipziger Zeit wiederholt mit der Johannes Passion befasst und sie auch mindestens viermal zur Aufführung gebracht. Der Bibeltext blieb gleich – natürlich. Bach übernimmt den Bibeltext seiner Oratorien und Passionen unverändert aus der Luther-Bibel mit zwei Ergänzungen aus der Passionsgeschichte des Matthäus.. Aber er verändert Chöre und Arien: fügt hinzu, lässt weg. Man gewinnt den Eindruck, als stellt die Arbeit an der Johannespassion einen Prozess dar, der sich über viele Jahre hinzieht. Mittlerweile ist die Geschichte dieses Werdens der Johannespassion in ihren Einzelheiten nachgezeichnet und beschrieben worden.
Immerhin zeigt dieser überlieferungsgeschichtliche Befund, dass Bach sich mit der „kleineren“ Passionsmusik nach dem Evangelisten Johannes intensiv auseinandergesetzt hat – dem Befund nach mehr als mit der größeren Matthäuspassion, die er gegen Ende seines Lebens noch einmal in Reinschrift vorlegt und wie die h-moll Messe und die Kunst der Fuge, wie die Clavierübungen und das „Musicalische Opfer“ für Kompositionen hält, die ihn und seine Zeit überdauern werden. Die Johannespassion ist ein Kunstwerk im Werden, auch wenn wir es als eine fertige Komposition hören, wenn sie bei uns zum festen kulturellen Bestandteil vorösterlicher Musik geworden ist: aufgeführt in nahezu jeder mittleren Stadt in Deutschland, gesungen von professionellen Chören und von Laienmusikern, angehört von Menschen, die vielfach dem traditionellen Christentum längst entfremdet sind. Konfessionsgrenzen hat die Kirchenmusik Bachs längst überwunden.
Es scheint, und es hat in der Tat Stimmen gegeben, die meinen, man könne die Musik losgelöst von ihrem Inhalt hören, den Klang vom Text abheben und so ein allgemeines ästhetisches Erlebnis erreichen, das nun einmal in die Form der protestantischen Gottesdienstmusik des 18. Jahrhunderts gekleidet ist, wobei dieses Kleid eben nur ein Kleid ist, das die wahre Gestalt der Musik zeitbedingt verhüllt.
Diese ästhetisierende Sicht auf die Johannespassion würde verkennen, dass es in der künstlerischen Absicht Bachs liegt, durch seine Musik den Text auszulegen, wobei der Text des Evangeliums selbst die bestimmende Rolle spielt.
Zeitgleich zu Bach und auch später wird man in den oratorischen Passionsmusiken, die nicht mehr in den Karfreitagsgottesdiensten aufgeführt werden, den Bibeltext durch paraphrasierende Nachdichtungen ersetzen. Bach zitiert Bibeltext – wie vor ihm schon Heinrich Schütz – aber im Gegensatz zu ihm fügt er Musikstücke hinzu, die Texten freier Dichtung folgen, du die so das vorgestellte biblische Geschehen deuten, nachvollziehen, vertiefen und auf die gegenwärtige Situation der glaubenden Gemeinde hin auslegen. Also stellen wir vor allem anderen zunächst die Frage nach dem Bibeltext selbst, nach seinem Aufbau, seinen Voraussetzungen und Implikationen.
2. Die Passionserzählung nach Johannes
In der neutestamentlichen Forschung ist man sich darüber weitgehend einig, dass es sich bei den Berichten über das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu nicht um primäre Augenzeugenberichte handelt. Die Evangelisten sind Sammler und Redakteure. Sie haben das vorliegende Material gesammelt, bearbeitet, verglichen und zusammengefügt. Dabei hat jeder der vier Evangelisten – so sehr sie sich in ihren Berichten in den Grundzügen auch gleichen – seine eigene Absicht, seine eigene Theologie, die ihn bei der Auswahl und Zusammenfassung leitet.
Während Matthäus daran gelegen ist, die Jesus-Geschichte im Licht der alttestamentlichen Verheißungen zu deuten und es das offenkundige Interesse des Lukas ist, die Römer von der Schuld am Tode Jesu zu entlasten, möchte Johannes hervorheben, dass der Jesus, der zum Kreuz geht, kein anderer ist als der fleischgewordene Gott, von dem er im 1. Kapitel seines Evangeliums erzählt. Jesus bleibt souverän – auch und gerade auf seinem Weg zum Kreuz. Als die Tempelwache in verhaften will, stürzen die Soldaten ohnmächtig zu Boden.
Im Gespräch mit Pontius Pilatus wird deutlich, dass Jesus ein König ist, auch wenn sein Reich nicht von dieser Welt ist. Selbst im Spott der Folterer trägt Jesus die Königskrone aus Dornen und den Königsmantel, der die Spuren der Schläge nicht verdecken kann. Und letztlich sind die letzten Worte Jesu nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums „Es ist vollbracht!“ Gott am Kreuz – der Schöpfer selbst zum Tode verurteilt und hingerichtet. Mit der Logik verträgt es sich nicht. Und die christliche Theologie hat sich der Lehre von der Dreieinigkeit Gottes bedient, um den Tod und das Leben Gottes gleichzeitig denken zu können. Sehr eng mit der Theologie des Johannesevangeliums verwandt ist der urchristliche Hymnus, den Paulus in seinen Philipperbrief aufgenommen hat.
Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht: Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. (Philipper 2,5-11)
Der Weg des Sohnes Gottes geht von Gott zu Gott. Und was von außen betrachtet wie ein unentwirrbares Geflecht von schuldhafter Verstrickung und politischem Kalkül, von menschlicher Brutalität und göttlichem Schweigen aussieht, das erweist sich aus der Perspektive des Glaubens als die eine Lebensgeschichte, die alle anderen Lebensgeschichten mit einschließt. Der Herr geht für alle ans Kreuz, damit alle, die an ihn glauben auch mit ihm leben.
Johannes, der Evangelist ist kein Augenzeuge. Er greift auf Erzählungen aus den jungen christlichen Gemeinden zurück und gestaltet sie im Hinblick auf seine theologische Intention. Dieser gestaltenden Bearbeitung ist es geschuldet, dass die an der Passionsgeschichte Jesu beteiligten Menschen und Menschengruppen eher holzschnittartig gezeichnet werden. Die Jünger Jesu versagen angesichts seines Geschicks – mit Ausnahme des geheimnisvollen johanneischen Lieblingsjüngers, dem Jesus unter dem Kreuz seine Mutter anvertraut.
Der Hohepriester steht für die religiöse Elite des Judentums, die sich am und um den Jerusalemer Tempel herum angesiedelt hat. Zu dieser Elite ist Jesus wiederholt in den offenen Widerspruch getreten. Pontius Pilatus steht für die Römische Besatzungsmacht. Sein offenkundiges Interesse ist der Machterhalt. Dem opfert er auch den Jesus von Nazareth, an dessen Schuld aus seiner Sicht Zweifel immerhin möglich sind. “Die Juden“ repräsentieren das Volk, das Jesus ablehnt, und in sofern stehen sie auch bei Johannes für die Welt, die Gott nicht aufgenommen hat: „Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf!“
Die Passionserzählung des Evangelisten Johannes ist eine Sicht auf die Leidensgeschichte Christi, die durchaus die Bedeutung des Kreuzes für die Rede von Gott selbst reflektiert. Es ist eine dramatisierende Erzählung: In kurzem Wechsel folgen die Fragen des Pilatus und die Antworten des Volkes. Die Passionserzählung des Johannes ist eine theologisch besonders profilierte Darstellung des Leidens, Sterbens und Auferstehens Jesu Christi, aber sie ist nicht die einzige Darstellung, die uns überliefert ist.
Im Neuen Testament stehen ihr die Passionserzählungen von Markus, Matthäus und Lukas zur Seite, die jede auch auf ihre eigene Weise konturiert sind und andere theologische Akzente setzen als Johannes. Und es gibt darüber hinaus noch Passionserzählungen zweifelhafter Herkunft oder legendärer Ausschmückung in den sogenannten „apokryphen“ Evangelien aus den ersten 4 nachchristlichen Jahrhunderten, die von der christlichen Kirche nicht als autoritative Schriften anerkannt worden sind.
Theologie ist immer auch eine Sache der Perspektive. Mehrere unterschiedliche Perspektiven müssen einander nicht ausschließen, sie können auch einander ergänzen, können vor Einseitigen Festlegungen bewahren. Gewiss: es geht immer um die eine Jesus-Geschichte. Aber unterschiedliche Menschen haben sie unterschiedlich gesehen, erfahren und geglaubt. Das spiegelt sich schon im Neuen Testament wieder und erst recht in der kirchlichen und musikalischen Tradition, die diesen Texten gefolgt ist.
In den Gottesdiensten der Karwoche hat man diesen unterschiedlichen Texten dadurch Rechnung getragen, dass man – beginnend mit dem Palmsonntag zunächst die Erzählung vom Einzug Jesu in Jerusalem (Joh. 12,12-19) und ab dem Montag fortsetzte mit der Lesung der Leidensgeschichte nach Matthäus, am Dienstag der nach Markus und am Mittwoch der Karwoche wurde die lukanische Passionsgeschichte gelesen. Der Donnerstag war der Erzählung von der Einsetzung des Abendmahls vorbehalten und der Karfreitag stand ganz im Zeichen der Johanneischen Passionsgeschichte. Die Anordnung der einzelnen Lesungen lässt durchaus eine Wertigkeit erkennen: Über Johannes schrieb der Kirchenvater Augustinus (354 - 430 n. Chr.):
Unter den ... vier Büchern eines Evangeliums hat der heilige Apostel und Evangelist Johannes, welcher gemäß seiner geistigen Erkenntnis dem Adler verglichen wird, höher und weit erhabener als die anderen drei seine Verkündigung erhoben und dadurch auch uns erheben wollen. (Tract. 36. in Joh. Nr. 1)
Noch deutlicher äußert sich Martin Luther in seiner Vorrede zum Neuen Testament:
Weil nun Johannes gar wenig Werke von Christus, aber gar viele seiner Predigten beschreibt, umgekehrt die andern drei Evangelisten aber viele seiner Werke und weniger seiner Worte beschreiben, ist das Evangelium des Johannes das einzige, schöne, rechte Hauptevangelium und den andern dreien weit, weit vorzuziehen und höher (als sie) zu heben
Johann Sebastian Bach ist nicht nur im überlieferten und gelebten Luthertum Mitteldeutschlands aufgewachsen, er hat sich die Theologie Martin Luthers und seiner Nachfolger explizit selber zu eigen gemacht. Die Auflistung der Bücher seiner Bibliothek, die nach seinem Tode angefertigt worden ist, zeigt, wie sehr der Thomaskantor selber nicht nur lutherischer Christ, sondern auch lutherischer Theologe gewesen ist.
Als solcher wird auch er dem Johannesevangelium seinen besonderen Ort im Kanon der biblischen Bücher zugemessen haben. Und also wird er auch bei der Komposition der Johannes Passion eine besondere musikalische und theologische Sorgfalt an den Tag gelegt haben. Rudolf Smend hat in seiner großen Arbeit über die Johannes Passion auf die durchdachte Architektur dieses Werkes hingewiesen, und er hat deutlich gemacht, wie die musikalische Gestaltung einem theologischen Programm folgt.
Wer sich mit dem kirchenmusikalischen Werk Johann Sebastian Bachs beschäftigt, der hat sich unweigerlich auch mit der lutherischen Theologie des 16. – 18. Jahrhunderts zu beschäftigen. In der Entwicklung der evangelischen Kirchenmusik ist Bach wohl der letzte für den diese enge Verbindung von Schrift und Schriftauslegung, von Choral und Bekenntnis gilt. Nach ihm kam die Aufklärung, die sich von den dogmatischen Traditionen gelöst hat, für die Bibeltext und Choral nicht mehr die normative Bedeutung für die Gestaltung der Kirchenmusik hatte, wie das noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts in der evangelischen Kirche die Regel war.
3. Die Passionsmusiken in der evangelisch-lutherischen Kirche
Es ist wahrscheinlich, dass man in der christlichen Kirche die Lesungen nicht mit Sprechstimme vorgetragen, sondern in bestimmten „Lektionstönen“ gesungen hat. Singen trägt in großen, halligen Räumen nicht nur besser als die Sprechstimme. Das Singen nach vorgegebenen Lektionstönen bewahrt auch vor allzu individueller Deutung und Interpretation. Dabei legt es sich von selbst nahe, dass man die dramatischen Passionserzählungen der Evangelien auch mit verteilten Rollen gesungen hat. Bestimmte Rollen bildeten sich heraus.
Der Erzähler, auch Evangelist genannt wird von der Tenorstimme verkörpert. Die Christusworte sind der Bassstimme zugeordnet. Die übrigen Gestalten der Passionsgeschichte verteilen sich auf die hohen Männerstimmen (Frau des Pilatus, Magd) und auf die Männerstimmen. Der Chor übernimmt die Rolle der Priester, der Jünger, des Volkes und der Soldaten. Im Prinzip gilt diese Aufteilung der Rollen in der Passion bis zu Johann Sebastian Bachs großen Passionen. Im Gegensatz zu der ursprünglich beabsichtigten „Objektivität“ bei der Praxis der kantilenen Lesungen, wird hier aber nun doch die individuelle Hervorhebung der einzelnen Rollen in ihren Situationen möglich.
Die Passionsmusiken Heinrich Schütz´s gehören zu diesem Passionstyp der gottesdienstlichen Vokal-Passion. Die Passionsvertonung steht im Gottesdienst an der Stelle der Evangelienlesung. Sie beginnt mit einem einleitenden Chorsatz: Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus wie uns das beschreibet der heilige Evangelist Johannes - und sie schließt mit einem vom Chor gesungenen Dankgebet: O, hilf, Christe, Gottes Sohn. Der Bibeltext wird gesungen und auf die bekannten Rollen verteilt. So entstehen Auslegung und Ausdruck allein mit den mitteln der chorischen und der solistischen Singstimmen.
Erst später, in der Generation nach Heinrich Schütz treten zu der gesungenen Passion die Instrumente hinzu, und noch eine Generation später werden die Formen aus der italienischen Oper, Rezitativ und Arie als Elemente der Deutung des Geschehens und der Anteilnahme an diesem Geschehen in die Passionsmusiken übernommen. In Kreisen der Pietisten regt sich Widerstand gegen diese „opernhaften“ Kirchenmusiken. Bachs große Passionsmusiken gehören zu den letzten Vertonungen und Bearbeitungen der biblischen Passionsberichte, die noch ihren angestammten Platz im evangelisch-lutherischen Gottesdienst haben. Schon die Passionsmusiken von Carl Philipp Emanuel Bach sind Erbauungsmusiken, die nicht mehr in der Kirche, sondern die im Konzertsaal aufgeführt werden. Mit den großen Passionen Johann Sebastian Bachs erlebt die evangelisch-lutherische Kirche den Höhepunkt ihrer gottesdienstlichen Musik.
4. Die Quellen
Von der wichtigsten Quelle, der Passionserzählung des Evangelisten Johannes war schon die Rede. An zwei Stellen fügt Bach kurze Abschnitte aus der Passionserzählung des Evangelisten Matthäus ein. Sie betreffen die Erzählung von der Verleugnung des Petrus und die Erzählung von dem Erdbeben, das Jerusalem nach dem Tod Jesu erschütterte und dem zerrissenen Tempelvorhang. Bach hat diese Einfügungen aus dem Matthäusevangelium der Passionsharmonie des Johannes Bugenhagen entnommen. Die Einfügungen dienen beide der dramatischen Steigerung des Berichtes.
Das bei Matthäus berichtete Weinen des Petrus über seinen Verrat ist ein starker Affektausdruck. Diesen nimmt die folgende Tenor-Arie auf „Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin.“ - noch stärker in der Choralstrophe:
Petrus, der nicht denkt zurück,
Seinen Gott verneinet,
Der doch auf ein' ernsten Blick
Bitterlichen weinet.
Jesu, blicke mich auch an,
Wenn ich nicht will büßen;
Wenn ich Böses hab getan,
Rühre mein Gewissen!
Und das Arioso „Mein Herz, in dem die ganze Welt bei Jesu Leiden gleichfalls leidet“ nimmt die Schilderung des Erdbebens und des zerrissenen Vorhangs im Tempel auf.
Eine weitere Quelle ist das Evangelische Gesangbuch. In den verschiedenen regional unterschiedlichen Gesangbüchern finden sich die Choräle, die von der versammelten Gemeinde im Gottesdienst und von den bürgerlichen Familien in den Häusern gesungen werden. Die Choräle sind wie keine andere Textgattung, Spiegel der Frömmigkeit ihrer Zeit. Das gilt für die öffentliche und für die Privatfrömmigkeit. Die an Bibel und Katechismus angelehnte Sprache der evangelischen Lieder prägt die religiösen Vorstellungen der Menschen und ihre Theologie.
Die evangelischen Choräle sind das Kulturgut der Gemeinden – ja sie sind ihr anvertrauter Besitz. In der Chorälen der Kantaten, Oratorien und Passionen Bachs kommt die Gemeinde selbst zu Wort, auch wenn sie die Liedstrophen in den Kantaten, Passionen und Oratorien selbst nicht mitgesungen, sondern sie betend, meditierend und erinnernd mitvollzogen hat. In den Chorälen der Johannes Passion ist die gegenwärtige Gemeinde präsent. In den Chorälen setzt sich die Gemeinde selbst in Beziehung zu der Passionsgeschichte Jesu Christi. Was dort musikalisch verhandelt wird, das ist ihre eigene Sache – über den breiten Graben der Geschichte hinweg.
Bach greift zurück auf einen Text des Hamburger Juristen und Erbauungsdichters Christian Heinrich Postel (1658-1705) – so auf die Strophe „Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn ist uns die Freiheit kommen“ – Sie entstammt einer lange fälschlich Georg Friedrich Händel zugeschriebenen Johannespassion . Und er nimmt die Liedstrophe „Ach mein Sinn, wo denkstu weiter hin?“ des zeitgenössischen Theologen und Dichters Christian Weise (1642-1708)23 zum Vorbild für die Arie „Ach mein Sinn, wo willstu endlich hin“
Die neben Bibel und Gesangbuch wichtigste Quelle für die Texte freier Dichtung in Bachs Johannes Passion ist die Dichtung: „Der für die Sünde der Welt gemarterte und Sterbende Jesus“ (1712) des Hamburger Ratsherren und Bürgermeisters von Ritzenbüttel Barthold Hinrich Brockes (1680-1747) .
Sein Hauptwerk „Irdisches Vergnügen in Gott“ gilt in der Literaturwissenschaft als herausragendes Beispiel für die spätbarocke Naturlyrik. Brockes Passions-Dichtung erfreute sich bei den zeitgenössischen Kirchenkomponisten allgemeiner Beliebtheit. Diesen Text haben sowohl Reinhard Keiser (1674-1739) als auch Georg Friedrich Händel (1685-1759), Georg Philipp Telemann (1681-1767) und Johann Matthesson (1681-1764) wie auch Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749) vertont. Eine überaus beliebte Textvorlage, die sowohl den Geschmack der Zeit trifft als auch den Komponisten durch die Farbigkeit ihrer Sprache hinreichend Möglichkeiten zur Vertonung lässt.
Bach hat den Text für sieben Arien und Ariosi aus dieser Textvorlage entnommen, wobei er keinen dieser Texte unbearbeitet gelassen hat. Die Bearbeitungen dienen allgemein der Klarheit und Einfachheit der Textaussage. Sie dienen aber auch der theologischen Präzision. Bach übernimmt keine Texte, die seinem theologischen Anspruch nicht genügen können. Für ihn ist die Passion Jesu keine Darstellung des allgemeinen Menschenschicksals, das seine Bedeutung in der „Hoheit des Leidens“ und in der vorbildhaften, menschlichen Größe des Leidenden. Bach ist in der Auswahl seiner Texte vielleicht nicht immer so glücklich, dass die poetische Qualität den Zeitgeschmack überdauern würden. Theologisch ist er anspruchsvoll. Das wird deutlich wenn man die Texte der Vertonungen der Brockes Passion durch Bachs Zeitgenossen gegen seine eigenen Texte hält.
Wie groß der Anteil Johann Sebastian Bachs an der Textfassung der Johannes Passion insgesamt ist, ist in der Bach-Forschung umstritten. Man hat allerdings vermutet, dass die Bearbeitungen fremder Texte und auch die Autorschaft der nicht anderweitig belegten Texte der Johannes-Passion auf Johann Sebastian Bach selbst zurückgeht.
Brockes Passion Nr.1
Georg Friedrich Händel
Mich vom Stricke meiner Sünden zu entbinden,
Wird mein Gott gebunden.
Von der Laster Eiterbeulen
heilen,
Lässt sich verwunden.
Es muss, meiner Sünden Flecken zu bedecken,
Eignes Blut ihn färben,
Ja, es will, ein ewig Leben mir zu geben,
Selbst das Leben sterben.
Johannes Passion Nr.7
Johann Sebastian Bach
Von den Stricken meiner Sünden
Mich zu entbinden,
Wird mein Heil gebunden.
Mich von allen Lasterbeulen
Völlig zu heilen,
Läßt er sich verwunden.
Martin Geck hat in seiner Studie über die Johannes Passion auf den Textdichter der Matthäuspassion, Christian Friedrich Henrici verwiesen, der sich als Dichter Picander nannte. Bach soll mit ihm zusammen die Textbearbeitungen vorgenommen haben. Einen Beleg für die frühe Zusammenarbeit mit Bach gibt es aber nicht, genauso wenig wie die Annahme von Meinrad Walter, der den unbekannten Autor in dem Leipziger Pfarrer und Konrektor der Thomasschule Andreas Stübel sehen will. Alfred Dürr bleibt dabei, dass Bach als Autor solange nicht ernstlich infrage kommt, solange nicht auch andere Texte aus seiner Feder nachweisbar sind, die er vertont hat.
Die Frage wird wohl offen bleiben, solange sich nicht überzeugende Hinweise finden, die Klarheit schaffen können. Mir scheint es angesichts der theologischen Stringenz und dem durchdachten Aufbau des Textgerüstes der Johannes Passion keineswegs als ausgeschlossen, dass der Anteil Bachs an seinen Texten in der frühen Leipziger Zeit grösser ist als allgemein angenommen. Bach war nicht nur Musiker, er war auch Theologe. Warum sollte sich diese theologische Kompetenz nicht auch sprachlich geäußert haben?
Choräle, Arien und Ariosi deuten das biblische Geschehen und beziehen es auf die Gegenwart des einzelnen Gläubigen und auf den Glauben der versammelten Gemeinde. In diesen texten wird die Brücke versucht zwischen der Jesus-Geschichte im antiken Jerusalem und zwischen unserer Lebensgeschichte. Menschliche Grunderfahrungen versuchen diesen „garstigen Graben“ der Zeit, von dem Lessing gesprochen hatte, ebenso zu überspannen, wie die Affekte der Freude und des Schmerzes. Und außerdem schlagen diese Texte auch die Brücke zwischen dem Bibeltext und der gegenwärtig bedeutsamen Glaubensaussage. Die Bachschen Passionen gehören nicht nur in die Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts, sie sind auch bedeutsame Zeugnisse der biblischen Auslegungsgeschichte und der Entfaltung des christlichen Zeugnisses. Insofern gehört die Johannes Passion Johann Sebastian Bachs auch in die evangelische Predigtgeschichte.
Wie kann die alte Botschaft in unseren Ohren neu werden? Das Problem der sach- und zeitgemäßen Vermittlung beschäftigt die Kirche von Anfang an. Es hat unzählige Versuche gegeben, die biblische Erzählung zeitgemäßen Verstehensmöglichkeiten zu unterwerfen. Man hat die biblische Geschichte selber angefragt, ob sie in ihrer antiken Gestalt wirklich in der Lage ist, Gottes Wort aktuell zu bezeugen. Es gibt modernistische Versuche, die christliche Botschaft in eine allgemeine Spiritualität einzuordnen, und es gibt fundamentalistische Versuche, die davon ausgehen, dass die Hör- und Verstehensbedingungen sich seit der Antike nicht geändert haben und nur eine wortwörtliche Rezeption einen Zugang zur Wahrheit Gottes ermöglicht.
Die Bachschen Kantaten, Oratorien und Passionen gehen einen anderen Weg. In ihnen kommt der Bibeltext unverändert zur Sprache, aber Bach und seine Textdichter legen ihn aus, setzten ihn mit ihrer Gegenwart in Beziehung uns schaffen so Verstehen. Und es ist unsere Erfahrung des 20. und des 21. Jahrhunderts, dass diese Art der Vermittlung immer noch aktuell ist und bei vielen Menschen immer noch zu ihrem Ziel kommt.
5. Die Eingangschöre
Bach hat die Johannespassion zum ersten Male am Karfreitag 1724 in der Nikolai Kirche im Nachmittagsgottesdienst aufgeführt. Dieser Nachmittags-Gottesdienst war durch eine Stiftung eingerichtet worden, um den Leipzigern auch in einer der Hauptkirchen einen respektablen und musikalisch reichhaltigen Gottesdienst zu ermöglichen. Seit 1712 wurden in der Matthäikirche – in Leipzig auch Neue Kirche genannt - jedes Jahr am Karfreitag „oratorische Passionen“ aufgeführt, unter ihnen auch die Brockes Passion von Georg Philipp Telemann oder die Brockes Passion von Georg Friedrich Händel.
Diese eher kulturelle Veranstaltung als Gottesdienst angesehene Erbauungsstunde wurde von den Leipzigern gern angenommen – zu Lasten des Gottesdienstbesuches in den Hauptkirchen. Das Legat ermöglichte nun auch einen kirchenmusikalisch gewichtigen Gottesdienst, der auch in seinen Passionsaufführungen mehr den überlieferten, am biblischen Text orientierten Kompositionen, also den „oratorischen Passionen“ zu Gehör brachte. Mit der Verbindung von Bibeltext und Choral, Rezitativ, Arioso, Arie und Chor schafft Bach einen Kompromiss, der die überkommene Tradition wahrt und sie zum Neuen hin behutsam öffnet. Dieser Kompromiss der Aufführung der Johannes Passion sollte schon im folgenden Jahr angefragt werden und zu einschneidenden Veränderungen führen.
Der Eingangschor der Johannespassion folgt in seinem ersten Teil den Worten des 8. Psalms. „Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist sein Name in allen Landen!“ Damit ist das theologische Vorzeichen für alles Weitere gesetzt. Es geht um die Geschichte des Gottessohnes, der am Kreuz über die Mächte finanzierte, so wie es in den romanischen Triumphkreuzen dargestellt worden ist. Die dreimalige Anrufung Gottes „Herr, Herr, Herr“ weist deutlich auf die Dreieinigkeit Gottes hin, ebenso wie die dreiteilige Anlage des Eingangschores. Die bewegten Streicherstimmen über dem ruhenden Orgelpunkt der Continuo-Stimmenschaffen eine ebenso spannungsvolle wie dramatische Atmosphäre. Die beiden Flöten, die die Spannung bis zum ersten Einsatz des Chores noch erhöhen, fehlen in der ersten Version der Johannes Passion noch. Bach und sein Textdichter – wer immer es gewesen sein mag – deuten den 8. Psalm trinitarisch. Das entspricht ganz der johanneischen Theologie, die Gott ganz und gar in der Passion Jesu am Werke sieht.
Herr, unser Herrscher,
dessen Ruhm In allen Landen herrlich ist!
Zeig uns durch deine Passion,
Dass du, der wahre Gottessohn,
Zu aller Zeit,
Auch in der größten Niedrigkeit,
Verherrlicht worden bist!
Andererseits kommt diese großangelegte Komposition auf den Text freier Dichtung sehr dem Stil des Passionsoratoriums nahe, wie es jeden Karfreitag in der Neuen Kirche in Leipzig aufgeführt wurde. Vielleicht ist das der Grund, warum Bach zur Aufführung der Johannespassion im folgenden Jahr 1725 diesen Chor durch eine groß angelegte Choralbearbeitung ersetzt hat. O Mensch, bewein dein Sünde groß. Diese Choralbearbeitung findet ihren endgültigen Ort Karfreitag 1727 in der Matthäuspassion am Ende des ersten Teils.
Für diese Veränderungen sind vielfältige Gründe genannt worden. Es ist immerhin denkbar, dass die einflußreichen Kreise der Leipziger Hauptkirchen auf eine konservative, vor allem an Bibeltext und Choralstrophe orientierte Passionsmusik diese theologische und musikalische Korrektur bewirkt hat. Ähnliches betrifft auch den Schlußchor der Johannespassion, den Bach gegen die Choralbearbeitung O hilf Christe, Gottes Sohn aus der Kantate „Du wahrer Gott und Davids Sohn“ BWV 23 ausgetauscht hat. Beide Veränderungen, dazu noch die Streichung der beiden Bibeltextstellen aus dem Matthäusevangelium, lassen Überlegungen, die in diese Richtung gehen, als wahrscheinlich erscheinen.
O Mensch, bewein dein Sünde groß,
Darum Christus seins Vaters Schoß
Äußert und kam auf Erden;
Von einer Jungfrau rein und zart
Für uns er hie geboren ward,
Er wollt der Mittler werden.
Den Toten er das Leben gab
Und legt darbei all Krankheit ab,
Bis sich die Zeit herdrange,
Dass er für uns geopfert würd,
Trüg unsrer Sünden schwere Bürd
Wohl an dem Kreuze lange.
6. Deutung und Anteilnahme – die Arien
Die oratorische Passion Bachs folgt der seit dem Mittelalter vorgenommenen Einteilung der Passionsgeschichte in 5 Akte: 1. Jesus im Garten, 2. Jesus vor dem Hohen Rat, 3. Jesus vor Pilatus, 4. Jesus am Kreuz, 5. Die Grablegung - nach diesen Akten werden die Bibeltexte eingeteilt und diesen 5 Akten entsprechend werden vom Textdichter und vom Komponisten auch Arien und Choralstrophen zugeordnet.
Anders als in der Matthäuspassion behält Bach das berichtende Rezitativ (Rezitativo Secco, vom Basso Continuo begleiteter Sprechgesang) einzig dem Bibeltext vor. Deutende Solo-Partien verteilen sich auf Arioso (also orchestral begleiteten Gesang, der weder den berichtenden Ton des Rezitaives hat, noch die formale Geschlossenheit der Arie) und Arie, Formen, die aus der italienischen Oper in die protestantische Kirchenmusik übernommen worden sind.
In der Reformationszeit und nachfolgend im 17. Jahrhundert war und blieb der Vortrag des Bibeltextes weitgehend der Inhalt der figuralen Kirchenmusik. Die spätere Zeit, von Pietismus und Frühaufklärung gleichermaßen beeinflusst, sucht die Beteiligung an diesem fremden Geschehen der Passion Jesu. Sie will Beteiligung der Gemeinde und des Einzelnen. Ziel ist die Erbauung, die Nahrung für den Inneren Menschen. Die Musik kann Affekte erregen. Sie kann die Zeit dehnen und verkürzen. Ihre Kraft entfaltet sie in ihren Gegensätzen. So greift sie direkt nach der Emotionalität des Menschen, bis dahin, dass im Laufe der Zeit der Text ganz von der Musik aufgesogen wird und letztlich für die emotionale Bewegtheit des Einzelnen und auch des Publikums so gut wie keine Rolle mehr spielt.
Zu Bachs Zeit ist das noch anders. Der Text der Passionsdichtung hat das absolute Prä. Das Textbuch der Passionsmusik muss dem zuständigen Superintendenten zur Genehmigung vorgelegt werden. Immerhin ist die Passionsmusik Bestandteil eines Gottesdienstes, wenn auch dieser gegenüber den anderen Gottesdiensten in den Leipziger Hauptkirchen einige Veränderungen erfahren hat. Und in Leipzig ist man darauf bedacht, ganz im Fahrwasser der lutherischen Glaubenslehre zu bleiben und diesen Bekenntnisstandpunkt auch nicht „modernen“ Kantaten- und Passionstexten zu opfern.
Bach fügt die Arien seiner Johannespassion oft auf ein Stichwort hin ein. Dabei kann der weitere Verlauf der Handlung das „Stichwort“ in gänzlich anderem Licht erscheinen lassen. Petrus, der zu Beginn der Passionserzählung Jesus folgt, wird ihn bald darauf verleugnen. Das macht aber für die Dramaturgie der Passionsmusik die kurzzeitige Nachfolge nicht unerheblich. Es geht um den Moment des Bibeltextes, der in der Arie ausgelegt wird. Andere Momente der Geschichte verlangen andere Deutungen und erhalten sie auch. Dieses „Stichwort“ trägt den musikalischen Gehalt und es schafft die Brücke zwischen dem Bibeltext und dem gegenwärtigen Hörer.
Evangelist
Simon Petrus aber folgete Jesu nach und ein ander Jünger.
Arie (Sopran)
Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten
Und lasse dich nicht,
Mein Leben, mein Licht.
Befördre den Lauf Und höre nicht auf,
Selbst an mir zu ziehen, zu schieben, zu bitten.
Die Arie ist nur mit 2 unisono spielenden Flöten und Basso Continuo besetzt. Die Flöten – sie mögen für „Petrus und den anderen Jünger“ stehen geben die Melodie vor, der der Sopran nach 16 Takten mit einer ähnlichen Bewegung der Stimme folgt. In der barocken Musiksprache nennt man diese Folge „Fuga“ wenn eine Stimme der andern in derselben Bewegung im Kanon oder m Abstand einer Quinte folgt, und dennoch nach einigen Takten jede Stimme auch wieder ihre eigenen Wege im Zusammenhang des Ganzen geht. Bach unterscheidet zwischen der Neugier, aus der heraus Petrus Jesus nachfolgt, um zu sehen, was mit ihm geschieht und der Nachfolge Christi, die ihren Grund im Glauben an den gekreuzigten und Auferstandenen Herrn hat. Nachfolge bedeutet dann: Christus ähnlich, aber nicht Christus gleich werden. Die Form der „Fuga“ vermag genau diese Glaubens-Bewegung musikalisch abzubilden.
Die Arie ist dreiteilig und Folgt dem Schema A-B-A, wobei der dritte Teil gegenüber dem ersten verändert ist. Es ist barocke Symmetrie und barocke Bedeutsamkeit. Zahlen sind mehr als reine Zahlen – man hat sogar versucht, das gesamte Werk Bachs in Zahlenverhältnisse zu übersetzen und so zu verstehen. Es fällt schwer, sich Bach mit dem Rechenschieber vorzustellen. Viele musikalische Zahlenzusammenhänge ergeben sich aus rein musikalischen oder auch aus textlichen Gründen. Bestimmte Zahlen jedoch verdienen bei Bach besondere Aufmerksamkeit: die zwei als Zahl der beiden Naturen Jesu Christi, drei, die für die Trinität Gottes steht und die 24 und die 42 mit denen Bach seinen Namen in seine Komposition musikalisch eingetragen hat.
Die Tonart der Arie ist t B-Dur, hat einen nahezu heiteren Charakter und steht so in deutlichem Gegensatz zu der vorhergehenden Alt-Arie „Von den Stricken meiner Sünden mich zu entbinden“ . Hinzu kommt der tänzerische Charakter der Komposition. – Ein Lichtblick in der Passionsmusik. Gleichzeitig ist es ein Gebet an den Herrn der Passion, dass die gläubige Hörerin und Sängerin im Bereich dieser Geschichte bleibt. Einen gänzlich anderen Charakter trägt die Arie, die auf das letzte Wort des sterbenden Jesus am Kreuz folgt.
Wieder ist die instrumentale Besetzung zunächst sehr sparsam. Die Viola da Gamba wird vom Basso Continuo begleitet. Die Gambe, ein altes Instrument in der Tonlage des Violoncello, aber mit Griffbünden ausgestattet wie die Gitarre, hat einen eigentümlich trockenen, zurückgenommenen Klang. Sie gibt der Trauerarie ihre eigene Färbung einer Totenklage43. Die Alt-Stimme greift die Worte des berichtenden Evangelisten auf, nicht nur textlich, sondern auch in der musikalischen Gestalt. Mit dem Auftakt zum 20. Takt verändern sich abrupt Besetzung, Tonart, Takt und damit auch der Charakter des Stückes. Aus der Totenklage wird eine Siegesfanfare: D-Dur ist die Tonart der Auferstehung in der h-moll Messe „et resurrexit“.
Die Altstimme geht mit der Fanfare voran „Der Held aus Juda siegt mit Macht!“, die Streicher fallen in repetierenden 16/teln ein – wie im 1. Satz des 5. Brandenburgischen Konzertes. Die Singstimme singt Koloraturen auf die Worte „Macht“ und Kampf“ – um dann wieder zurückzukehren zu der anfänglichen Totenklage „Es ist vollbracht“. Die Verbindung von Totenlage und Siegesmarsch spiegelt das Geschehen von Kreuz und Auferstehung Jesu Christi und sie entspricht auch der Theologie des Johannesevangeliums. Ohne den Sieg des Auferstandenen Christus bleibt sein Tod ein schreckliches Ereignis in einer Reihe schrecklicher Ereignisse, die die Menschengeschichte von Anfang an begleiten und erschüttern. Ohne den Tod Jesu am Kreuz wird der Glaube zu einer enthusiastischen und ekstatischen Religion, die den Zusammenhang mit dem wirklichen Leben und Sterben zu verlieren droht. „Kreuz und Krone sind verbunden “ heißt es bei Bach an anderer Stelle.
Evangelist
Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich. Darnach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllet würde, spricht er:
Jesus
Mich dürstet!
Evangelist
Da stund ein Gefäße voll Essigs. Sie fülleten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isopen, und hielten es ihm dar zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er:
Jesus
Es ist vollbracht!
Alt-Arie
Es ist vollbracht!
O Trost vor die gekränkten Seelen!
Die Trauernacht
Läßt nun die letzte Stunde zählen.
Der Held aus Juda siegt mit Macht
Und schließt den Kampf.
Es ist vollbracht!
7. Der Choral – die Stimme der Gemeinde
Im Choral ist die Gemeinde präsent. Im Choral kommt sie in der Passion zur Sprache. Aber im Choral findet sie sich auch wieder. „Bibelwort und Choral“ sind die beiden theologisch-liturgischen Schwerpunkte, die Luther und Bach miteinander verbinden. Seit der Reformation ist der Choral, das evangelische Kirchenlied die hörbare Form der Beteiligung der ganzen Gemeinde im Gottesdienst, in den reformierten Gemeinden ist es der Psalmengesang. Das Wort Gottes und die Antwort der Gemeinde entsprechen einander
Ohne das Bibelwort wäre die Gemeinde in der Passionsmusik ohne Grund, ohne den Choral wäre ihr Glaube lediglich eine historische Angelegenheit, die keinen Gegenwartsbezug mehr hat. Glaube ist „nicht nur eine gewisse Erkenntnis, dadurch ich alles für wahr halte, was uns im Evangelium geoffenbart ist, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist in mir wirkt...“ heißt es im Heidelberger Katechismus der reformierten Gemeinden, lutherischerseits würde man das kaum anders formulieren.
Die Gemeinde kommt zu Wort mit ihrer Betrachtung und auch mit ihrem Gebet. Für Bach steht der Choral zeitlebens in der Mitte seines Schaffens. Der Choral bestimmt die Orgelmusik, keine seiner nahezu 200 Kirchenkantaten kommt ohne eine Choralstrophe aus. In seinem Nachlass fanden sich über 300 Choralsätze, die sein zweitjüngster Sohn dann nach seinem Tode herausgegeben hat. Und auch seine Passionen sind von Choralstrophen durchzogen. Sie folgen der Dramatik des Bibeltextes. Bisweilen hört man zwei Choralstrophen kurz nacheinander, bisweilen ist dem Passionsgeschehen und seiner musikalischen Deutung in Arioso und Arie mehr Raum gegeben. An einer Stelle verbindet Bach Arioso und Choral und schließt damit die Gläubige Seele und die Gemeinde zusammen.
Eine besondere Bedeutung kommt der Choralstrophe zu „Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, muss uns die Freiheit kommen...“ . Dieser Text ist in der bekannten Gesangbuchliteratur des 17. und des 18. Jahrhunderts nicht nachgewiesen. Der Text stammt von Christian Heinrich Postel (1658-1705) einem Hamburger Poeten, der über einen beträchtlichen literarischen Ruf verfügte . Aus seiner Passionsdichtung erscheint dieser choralähnliche Text in einer lange Georg Friedrich Händel zugeschriebenen „Johannes-Passion“, die aber wohl in norddeutschem Umfeld anzusiedeln ist und heute entweder Georg Böhm (1661-1733) oder Christian Ritter (1645?- nach 1717) .
In dieser Passionsmusik erscheint der Text als Sopran-Arie:
Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn,
Muss uns die Freiheit kommen;
Dein Kerker ist der Gnadenthron,
Die Freistatt aller Frommen;
Denn gingst du nicht die Knechtschaft ein,
Müßt unsre Knechtschaft ewig sein.
Bach gestaltet diese Strophenarie um zu einer Choralstrophe um und unterlegt ihn mit der Melodie „Machs mit mir Gott nach deiner Güt“ von einem seiner Leipziger Vorgänger Johann Hermann Schein (1586-1630).
In der Architektur der Johannespassion bildet dieser Choral die Mitte der Schilderung des Prozesses Jesu. Friedrich Smend hat in dieser von Bach zur Choralstrophe erhobenen Text das Herzstück der Johannespassion gesehen . Um diese Choralstrophe herum ranken sich die dramatischen Szenen des 2. Teils der Passion: Rezitative und Chöre wechseln miteinander ab. Alles drängt auf den entscheidenden Entschluss des Gouverneurs hin. Ob er ihn frei lässt? Ob er dem Unschuldigen gerecht wird? „und von dem an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe!“ – heißt es lapidar.
Es ist wie der 4. Akt in der klassischen Tragödie, der den fatalen Lauf der Dinge noch einmal aufhält, der in der konsequenten Hoffnungslosigkeit noch einmal Hoffnung aufkeimen lässt. Die Choralstrophe widerspricht den falschen Hoffnungen. Sie rückt theologisch die Dinge zurecht. Es gibt keinen Weg am Kreuz vorbei. Es gibt keinen Weg zum Heil der Welt, der das Leiden Gottes an der Welt aussparte.
8. Weg, weg mit diesem! – Die Juden in Bachs Johannes Passion
Evangelist (T), Pilatus (B)
Evangelist
Da Pilatus das Wort hörete, führete er Jesum heraus und satzte sich auf den Richtstuhl, an der Stätte, die da heißet: Hochpflaster, auf Ebräisch aber: Gabbatha. Es war aber der Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde, und er spricht zu den Jüden:
Pilatus
Sehet, das ist euer König!
Evangelist
Sie schrieen aber:
Chor
Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!
Evangelist (T), Pilatus (B)
Spricht Pilatus zu ihnen:
Pilatus
Soll ich euren König kreuzigen?
Evangelist
Die Hohenpriester antworteten:
Chor
Wir haben keinen König denn den Kaiser.
Die Szene hat ihren Höhepunkt erreicht: Wie in der antiken Tragödie stehen die Protagonisten dem Volk gegenüber: Pilatus und Jesus auf der einen, das Volk auf der anderen Seite. Die Rede wechselt in kurzen Episoden. Chor folgt auf Rezitativ. Es geht um Leben und Tod. Jesus schweigt. Das Volk und Pilatus handeln über seinen Kopf hinweg.
Im Johannesevangelium ist das Volk „die Juden“, für Johannes kaum ein Problem, da er sich doch selber zu den Menschen des jüdischen Volkes zählt. Für die Nachgeborenen schon ein Problem, die sich nur noch im Gegenüber, in Konkurrenz und Feindschaft zu den Juden sehen können. Die Legende vom „Gottesmord“ durch die Juden hat hier ihren Ursprung.
Bach ist an der Dramatik des Geschehens interessiert. Gerade in den Chören läßt er den Leidenschaften freien Lauf. Er verknüpft die einzelnen Themen miteinander, legt die ganze Szene symmetrisch an, indem er gerade so deutlich macht, dass im Zentrum des Geschehens weder Pilatus noch die Juden, sondern einzig der Herr steht, der um unseretwillen ans Kreuz gegangen ist:
Durch dein Gefängnis, Gotts Sohn ist uns die Freiheit kommen!...
Als nach der Schoa deutlich wurde, dass der im Nationalsozialismus zutage getretene Antisemitismus seine tiefen Wurzeln im Antijudaismus der deutschen Geistesgeschichte, aber auch in der christlichen Theologiegeschichte hatte, gerieten auch Bachs Passionen in die Kritik. Man warf ihnen Antijudaismus vor. Die Art, wie Bach die Juden – vor allem in der Johannespassion – behandele, gebe dem Judenhass deutlichen Nahrung. Die Verstockung, die ich in den Wiederholungen der Turbae, der Volkschöre zeige, sei für eine aufgeklärte Gegenwart nicht mehr tolerierbar. Und also könne man auch dieses musikalische Werk nicht mehr oder nur noch verfremdet aufführen, indem man beispielsweise in die Passionsaufführung Stücke von Arnold Schoenberg oder Luigi Nono integrierte, um so den antijudaistischen Wohlklang zu durchbrechen.
Dass das Entsetzen über den Mord an der europäischen Judenheit bis in eine radikale Kritik der geistigen und theologischen Wurzeln reichen musste, ist nur zu verständlich. Es wäre unehrlich gewesen, wenn man diese Wurzeln von der Kritik ausgenommen hätte wie etwa Martin Luthers Schrift „Von den Jüden und ihren Lügen“ oder seine letzte Predigt zwei Tage vor seinem Tod in Eisleben. Und letztlich traf diese Kritik auch die Texte des Neuen Testaments selbst, vor allem das Johannesevangelium, das die Schuld am Tode Jesu vor allem den Juden zuschiebt, und in dem auch den Juden vorwirft, sie hätten den Teufel zum Vater.
In der polemischen Auseinandersetzung verschwimmen oft die Begriffe. Bevor man ein Verdikt ausspricht, sollte man sich darüber klar sein, was mit den in Frage stehenden Begriffen eigentlich gemeint ist. Ich denke: Antjudaismus ist eine in der heidenchristlichen Kirche der ersten Jahrhunderte Judenfeindschaft, die sich von außen – also von den Heidenchristen her – gegen die Judenheit richtet. Da werden die Juden als „Gottesmörder“ bezeichnet, man isoliert Jesus von seinem Volk – Jesus war in dieser Perspektive kein Jude mehr sondern der erste Christ, man spricht dem auserwählten Volk Gottes die Erwählung und die Zukunft ab. Und dabei gilt festzuhalten, was Walter Jens sagte: „Jesus von Nazareth, ein Bruder der Verhöhnten und Gefolterten in aller Welt.“
Johannes, der Evangelist ist selber Jude. Jesus ist Jude. Paulus ist auch Jude. Wie können sie antijudaistisch sein? Wenn Jesus, Johannes und Paulus jüdisches Leben und jüdische Verhaltensweisen kritisieren, dann ist das eine Form der innerjüdischen Kritik. Und wir wissen aus unserem Volk und aus unseren Familien, dass die Kritik, die von innen kommt, oft viel heftiger und viel zugespitzter ist als alle Kritik, die von außen kommt. So trifft der Vorwurf des Antijudaismus nicht Johannes, den Evangelisten, wohl aber Martin Luther, der in seinem maßlosen heidenchristlichen, leider auch noch von ihm selbst anscheinend theologisch begründeten Judenhass, alles an Vorurteilen zusammensucht und ein Programm entwickelt, wie man die Juden, die sich nicht zu Christus bekehren, behandeln soll.
Natürlich steht Bach auch in dieser lutherischen Tradition. Es ist unwahrscheinlich, dass er den Antijudaismus seiner Zeit nicht geteilt hat. Es gibt aber keinerlei Beweis dafür, dass er sich in dieser Richtung besonders hervorgetan hätte. Bach vertont die Worte des Evangelisten. Er setzt die textlichen Aussagen und Empfindungen in Musik. Er kritisiert den ihm vorliegenden Text nicht. Er bildet die Dramatik des Geschehens ab. Schlag auf Schlag treffen der Bericht des Evangelisten, die Worte Jesu und des Pilatus und die Chöre aufeinander.
In den deutenden und interpretierenden Texten er Johannespassion ist jedoch keine besondere Judenfeindschaft auszumachen. Vielmehr kann man ihm eine Ahnung davon unterstellen, dass die Ablehnung Jesu durch große Teile der Judenheit zum verborgenen Heilsweg Gottes gehören, wie Paulus das im 11. Kapitel des Römerbriefes entfaltet hat.
Es gibt unter den Bach zeitgenössischen Passionsmusiken andere Beispiele:
Carl Heinrich Graun, Der Tod Jesu (1754)
Jerusalem, voll Mordlust, ruft mit wildem Ton:
„Sein Blut komm über uns und unsre Söhn und Töchter!“
Du siegst: Jerusalem!
Und Jesus blutet schon;
In Purpur ist er schon des Volkes Hohngelächter
,
Damit er ohne Trost in seiner Marter sei,
Damit die Schmach sein Herz ihm breche.
Voll Liebe steht er da, von Gram und Unmuth frei,
Und trägt sein Dornendiadem
Und eine freche, verworfne Mörderhand faßt seinen Stab
Und schlägt sein Haupt;
Ein Strom quillt Stirn und Wang herab:
Seht, welch ein Mensch!
Des Mitleids Stimme
Vom Richtstuhl des Tyrannen spricht:
Seht, welch ein Mensch! –
Und Juda hört sie nicht,
Und legt dem Blutenden,
mit unerhörtem Grimme,
Den Balken auf,
woran er langsam sterben soll;
Er trägt ihn willig und sinkt ohnmachtsvoll.-
Nun kann kein edles Herz die Wehmut mehr verschließen,
Die lang verhalt´nen Tränen fließen;
Er aber sieht sich tröstend um und spricht:
Ihr Töchter Zions, weinet nicht!
Der Textdichter schafft sich eine Evangelienharmonie, indem er die 4 Passionsberichte der Evangelien zu einem zusammenfasst. Dann lässt er seinen Gefühlen freien Lauf. Er rühmt das Mitleid des Tyrannen und schmäht die Uneinsichtigkeit und Mitleidlosigkeit der Juden. Hier, so denke ich, kann man durchaus von Anti-Judaismus in einer Passionsmusik sprechen.
Bei Bach sollte man mit solchen Verdikten vorsichtig sein, zumal die betrachtenden Texte gerade in diesem Abschnitt der Johannespassion auch nicht den leisesten Hinweis darauf geben, dass die „die Juden“ für Leiden und Tod Jesu verantwortlich gemacht werden sollten.
9. Der doppelte Schlusschor
Eingangschor und Schlusschor rahmen die Passion ein. Das war schon bei den frühen Choralpassionen der Fall. Man orientierte sich an den Lesungen der Bibeltexte im Gottesdienst, die ja auch nicht ohne Einleitung und Schlussvotum sind. Das Bemerkenswerte an Bachs Johannespassion ist, dass sie in der ersten und den späteren Fassungen 2 Schlusschöre aufeinander folgen lässt. Zum einen ist es der Chor:
„Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine...“ dem folgt die Choralstrophe von Martin Schalling: „Ach, Herr, laß dein lieb Engelein“
Der Textdichter des großen Schlusschores ist unbekannt. Der Form nach ist er – wie auch der Schlusschor der Matthäuspassion ein Grabgesang. Aber Bach gibt ihm eine eindeutig andere Klangfarbe. Der Chor erinnert an einen Tanz-Satz aus einer Suite, im 3/4tel Takt: an eine Sarabande. Wiederholt ist bemerkt worden, dass der Musik etwas „weltliches“ anhaftet . Der Grabgesang fällt fast heiter aus, zumindest aber gelassen. Das Grab ist keine Endstation. Der Tod Jesu schließt die Hölle zu und den Himmel auf – eine Textzeile die an die alte Anschauung von der Höllenfahrt Christi zwischen Karfreitag und Ostersonntag erinnert. Bach zeichnet die theologischen Aussagen musikalisch nach. Er misst die Spanne zwischen Himmel und Hölle im Tonumfang.
Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine,
Die ich nun weiter nicht beweine,
Ruht wohl und bringt auch mich zur Ruh!
Das Grab, so euch bestimmet ist
Und ferner keine Not umschließt,
Macht mir den Himmel auf und schließt die Hölle zu.
Dennoch scheint Bach weder bei der ersten noch bei der 4. Fassung der Johannespassion dieser Chorsatz als Schlusspunkt der Passionsmusik gereicht haben. Ein Ende mit einem madrigalischen Chor gehört in der Tradition der Passionsmusiken zum Genus des Passionsoratoriums. Der Choral signalisiert die gottesdienstliche Verortung der Passionsmusik. Das letzte Wort erhält nicht die erbauliche Betrachtung des Passionsgeschehens durch den Chor. Das letzte Wort erhält die glaubende Gemeinde, die sich im Gebet an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn wendet. Aus der Leidensgeschichte Jesu Christi erwächst die Hoffnung auf die Auferweckung der Toten. Die der in seinem Tod den Tod überwunden hat.
Viele Bachschen Kirchenkantaten schließen mit diesem eschatologischen Ausblick in die Zukunft des Reiches Gottes, die auch zugleich die Zukunft der christlichen Gemeinde ist. So ist der Schlusschoral Gebet und Predigt zugleich, und die Passionsgeschichte bleibt nicht in der historischen und emotionalen Betrachtung stecken, sondern sie weitet sich und erinnert daran, dass wir es mit der Passion Jesu nicht um ein historisches Ereignis handelt, das bestenfalls beispielhaften Charakter haben kann, sondern das der Grund ist für das eigene Leben, die eigene Zukunft und die eigene Hoffnung.
Ach Herr, lass dein lieb Engelein
Am letzten End die Seele mein
In Abrahams Schoß tragen,
Den Leib in seim Schlafkämmerlein
Gar sanft ohn eigne Qual und Pein
Ruhn bis am jüngsten Tage!
Alsdenn vom Tod erwecke mich,
Dass meine Augen sehen dich
In aller Freud, o Gottes Sohn,
Mein Heiland und Genadenthron!
Herr Jesu Christ, erhöre mich, erhöre mich
Ich will dich preisen ewiglich
10. Zugänge und Wirkungen
Wenn wir die Kirchenmusik Bachs hören und verstehen wollen, dann begeben wir uns zurück in vergangene Zeiten, zu denen wir sonst keinen Zugang mehr haben. Wir blicken zurück hinter den Durchbruch der Moderne im Denken und Leben Europas. Die Frage ist, ob das überhaupt gelingen kann. Wenn wir Bach hören, dann haben wir vorher längst Beethoven und Brahms gehört. Die Beatles sind uns vertraut. Lenas Schlager dudeln aus allen Lautsprechern. Wir kennen den Klang von Presslufthämmern und startenden Flugzeugen. Leise Töne müssen wir erst entdecken.
Unser Hören ist vorbelastet. Aber unser Musizieren ist es auch. Wir können uns kaum vorstellen, wie die Johannes Passion bei ihrer ersten Aufführung geklungen hat. War das musikalische Erscheinungsbild des Thomanerchores wirklich so dürftig, wie Bach selbst das in seiner Denkschrift im Jahre 1730 an den Rat der Stadt Leipzig geschrieben hat? Viel wissenschaftlicher Fleiß und viele praktische Untersuchungen haben versucht, der Spielweise, dem Klang und der Bauart der Musikinstrumente des frühen 18. Jahrhunderts auf die Spur zu kommen. Aber haben sie wirklich so geklungen, wie professionelle Musiker, die ausnahmslos zunächst an „modernen“ Instrumenten geschult worden sind, sie heute klingen lassen?
Das Erstaunliche ist – und darin unterscheidet sich unsere Zeit wohl auch von allen vorigen Zeiten, dass diese Musik aus dem 18. Jahrhundert bei uns in einer Weise aufgeführt und rezipiert wird, wie das bei zeitgenössischer „klassischer“ Musik so nicht der Fall ist. Bachs Musik klingt nach wie vor – ja er klingt heute weiter als sie zu seinen Lebzeiten geklungen hat. Wir werden noch darauf zurückkommen und fragen, woran das liegen könnte.
Es liegt gewiss nicht an der Sprache der Texte. Die Sprache des 17. und des 18. Jahrhunderts ist uns fremd. Wir mögen den barocken Schwulst nicht mehr, viele Bilder bleiben unverständlich, viele Ausdrücke umständlich und verschroben. Am 27. April 1827 schreibt der Leiter der Berliner Singakademie Karl Friedrich Zelter (1758-1832) an Johann Wolfgang von Goethe (1749- 1832).
„Das größte Hindernis in unserer Zeit, liegt freilich in den ganz verruchten deutschen Kirchentexten, welche dem polemischen Ernste der Reformation unterliegen, indem sie durch einen dicken Glaubensqualm den Unglauben aufstören, den niemand verlangt. Daß ein Genie, dem der Geschmack angeboren ist, aus solchem Boden einen Geist aufgehen lassen, der eine tiefe Wurzel haben muß, ist nun das Außerordentliche an ihm...“
Hinter dieser Aussage steht die Vorstellung, man könne unterscheiden zwischen dem idealen Gehalt der Bachschen Musik und der historischen Zufälligkeit ihrer Textgestalt. Besonders die Arbeit Albert Schweitzers hat gezeigt , dass dieses so nicht möglich ist. Es gibt bei Bach eine Wort-Ton-Beziehung, die nicht aufgelöst werden kann: Es ist Musik auf diese Texte und es sind Texte für diese Musik. Dass sie uns bisweilen fremd sind, steht außer Frage, und man wird die Fremdheit nur dann überwinden können, wenn man die Texte sieht als Glaubensaussagen von Menschen, die vor uns gelebt und geglaubt haben, die eine andere Sprache und einen anderen Horizont hatten. Und man wird herausfinden, wie sie sich mit ihren Sprachbildern auf die Bibel beziehen und die Bibel wieder aus der Vergessenheit hervorholen. Man wird auch entdecken, wie ihre fremd anmutende Emotionalität eigene Zugänge zu den oft verschlossenen Türen des Glaubens schaffen kann.
Über alle immer wieder bewiesene Aktualität hinaus ist die Johannespassion von Johann Sebastian Bach ein Werk, das nahezu 300 Jahre alt ist. Sie hat überlebt. Die meisten Texte und Musiken jener Zeit haben es nicht. Sie ist auch ein historisches Dokument und will auch als solches angesehen und aufgenommen werden.
Historische Arbeit ist immer Annäherung – und niemand kann genau sagen, wie weit diese Annäherung reicht. Das macht auf der einen Seite eine Kopie oder exakte Wiederbelebung dessen, was einmal gewesen ist, unmöglich, das eröffnet auf der anderen Seite aber auch Freiheiten des Verständnisses, der Deutung, der Interpretation. Im Blick auf die Bachsche Johannes Passion heißt das: Wir kennen ihren Text, den Bibeltext, den Text der Choräle und Chöre, der Rezitative und Arien, und wir kennen die Partitur, manche Spuren können wir verfolgen, manche Sinnzusammenhänge erschließen.
Aber dennoch muß jede Generation, jeder Interpret, jeder Chor und jeder Solist, jedes Orchestermitglied und auch jede Hörerin und jeder Hörer seine eigene Johann es Passion immer wieder „erfinden“. Es gibt keine Dogmen darüber, wie die Passion letztgültig aufzuführen ist. Es gibt das Wagnis der Aufführung Alter Musik, und es ist erstaunlich, wie diese Musik über die Zeiten hinweg wirkt, wie Menschen durch sie angerührt werden und wie sie in diesem ästhetischen Kontext mit den grundlegenden Texten und Aussagen des Christlichen Glaubens in Kontakt gebracht werden.
Ob die Musik letztlich die Brücke zwischen der Botschaft des Johannesevangeliums und den Zeitgenossen schlagen kann, das bleibt menschlichem Einflussvermögen entzogen, genau wie die Wirkung der Predigt und der Schriftauslegung nicht in den Händen der Predigenden liegt. Aber wie der Prediger und die Predigerin dennoch Sonntag für Sonntag verantwortet das ihre sagen, so sagt es die Johannes Passion auch. Dabei transportiert sie durchaus auch Zeitgeschmack und zeitlich bedingte theologische Färbungen. Aber das tun wir aber mit unserem Reden auch.
Erstaunlich bleibt der musikalische und theologische Gehalt, der die Zeiten überdauert hat. Und sie hat die Zeiten nur in dieser unlöslichen Verbindung von Text und Musik, von Inhalt und ästhetischer Form überdauert. Und sie wird auch nur in dieser Verbindung bleiben. Die Johannes Passion von Johann Sebastian Bach ist ein Dokument und ein lebendiges Zeugnis des christlichen Glaubens. Es kommt darauf an, sie so wieder und wieder zum Klingen zu bringen und zu hören.
Halle, den 21. März 2011 (326. Geburtstag Johann Sebastian Bachs)
Domprediger Martin Filitz, Halle